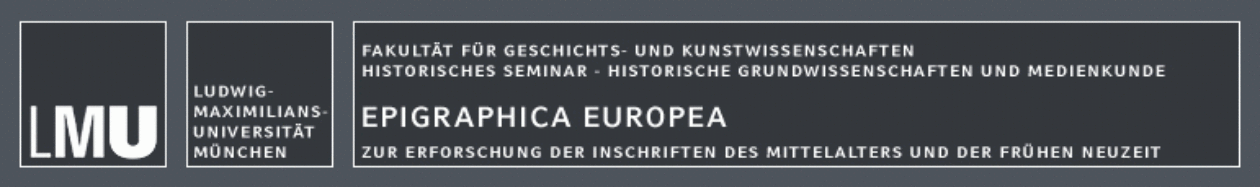Epigraphik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Eine Einführung, hg. von Helga Giersiepen und Andrea Stieldorf unter Mitarbeit von Sonja Hermann, Franz Jäger, Susanne Kern, Christine Magin und Ulrike Spengler-Reffgen. Wiesbaden (Reichert) 2025. ISBN: 9783752006216. EUR 59,-
Aus der über Jahrzehnte erwachsenen Expertise in der Epigraphik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes „Die Deutschen Inschriften“ ein Lehrbuch der Epigraphik erstellt, das sich sowohl an Studierende als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen und ebenso an interessierte „Nichtfachleute“ richtet. Vermittelt wird Basiswissen zu Materialien und Techniken, die für die Herstellung von Inschriften verwendet werden, die Sprachen, in denen die im Projekt bearbeiteten Inschriften verfasst sind, die wichtigsten Texttypen mit ihren Inhalten und Funktionen, zu den Quellen, aus denen bei der Abfassung von Inschriftentexten geschöpft wurde, und über den Umgang mit der kopialen Überlieferung. Die spezifisch epigraphische Expertise entfaltet sich im Kap. 7 in den Beschreibungen der Schriften. Daran schließen sich noch eine Anleitung zur Erfassung und Edition von Inschriften sowie ein größeres Kapitel zur digitalen Epigraphik an. Am Schluss folgen einige Hilfsmittel (Verlagsanzeige).
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 13
1. Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 17
1.1. Inschriften als Quellen (Helga Giersiepen) 17
1.2. Wissenschaftsgeschichte (Andreas Zajic) 23
2. Material und Technik 41
2.1. Inschriften in Stein 41
2.1.1. Naturstein – Bearbeitung – Schrifthauen (Philipp Stastny/Renate Kohn) 41
2.1.2. Steinätzplatten (Christine Steininger) 46
2.2. Inschriften in Metall I: Goldschmiedekunst (Jitka Ehlers) 50
2.3. Inschriften in Metall II: Bronze- und Messingguss, Eisenguss, Inschriften in Blei (Jörg H. Lampe) 61
2.4. Inschriften auf Textilien (Gudrun Sporbeck) 73
2.5. Inschriften in der Glasmalerei (Maria Deiters) 85
2.6. Inschriften in der Wandmalerei (Susanne Kern) 93
2.7. Inschriften aus Holz (Franz Jäger) 103
3. Die Sprache der Inschriften 109
3.1. Mittel- und Neulatein (Jens Borchert-Pickenhan/Mona Dorn) 109
3.2. Deutsch 115
3.2.1. Hochdeutsch (Hans Ulrich Schmid) 115
3.2.2. Niederdeutsch (Christine Wulf) 124
3.3. Griechisch (Henning Ohst) 129
3.4. Hebräisch (Michael Oberweis) 134
4. Texte: Inhalte und Funktionen 143
4.1. Inschriften des Totengedenkens (Franz Jäger) 144
4.2. Stifter-, Stiftungs-, Schenkungs- und Auftraggebervermerke (Ulrike Spengler-Reffgen) 159
4.3. Bildbeischriften: Inschriften zwischen Text und Bild (Kristine Weber) 169
4.4. Künstlersignatur/Meistersignatur und andere Formen der Urheberschaft (Susanne Kern) 184
4.5. Bauinschriften (Gertrude Mras) 191
4.6. Historische Nachrichten (Gertrude Mras) 198
4.7. Rechtsinschriften 205
4.7.1. Urkundeninschriften (Martin Riebel) 205
4.7.2. Sonstige Rechtsinschriften (Christine Magin) 209
4.8. Inschriften auf Glocken (Cornelia Neustadt/Jan Ilas Bartusch) 214
4.9. Graffiti (Sonja Hermann) 225
5. Textvorlagen 237
5.1. Bibel (Christine Wulf) 238
5.2. Liturgie (Ulrike Spengler-Reffgen) 245
5.3. Antike, mittelalterliche und frühneuzeitliche Autoren (Jens Borchert-Pickenhan) 255
6. Kopiale Überlieferung (Renate Kohn) 265
7. Entwicklung der epigraphischen Schriftarten 277
7.1. Vorkarolingische Kapitalis (Eberhard J. Nikitsch) 278
7.2. Kapitalisschriften von der Karolingerzeit bis um das Jahr 1000 (Karolingische Kapitalis und Frühe Kapitalis) (Rüdiger Fuchs) 290
7.3. Romanische Majuskel (Helga Giersiepen) 302
7.4. Gotische Majuskel (Rüdiger Fuchs) 310
7.5. Gotische Minuskel (Christine Magin/Christine Wulf) 320
7.6. Frühhumanistische Kapitalis (Andreas Zajic) 327
7.7. Renaissance-Kapitalis und Kapitalis der Frühen Neuzeit (Franz-Albrecht Bornschlegel) 335
7.8. Fraktur (Renate Kohn) 343
7.9. Humanistische Minuskel (Hans Fuhrmann) 351
7.10. Gotico-Antiqua (Ramona Baltolu) 358
7.11. Ziffern (Katharina Kagerer) 363
7.12. Interpunktionszeichen und Worttrenner (Eberhard J. Nikitsch) 366
7.13. Glossar zum Kapitel „Entwicklung der epigraphischen Schriftarten“ (Sonja Hermann) 371
8. Erfassung und Edition von Inschriften (Stefan Heinz/Raoul Hippchen) 375
9. Digitale Epigraphik 385
9.1. Zu den Anfängen der digitalen Epigraphik (Jörg Witzel) 385
9.2. EpiDoc und Normdaten (Thomas Kollatz/Markus Studer) 386
9.3. Datenmodellierung und Modellbildung (Max Grüntgens) 387
9.4. Spatial Humanities (Maximilian Kopp/Torsten Schrade/Markus Studer) 391
9.5. Linked Open Data und Knowledge Graphs (Max Grüntgens/ Torsten Schrade) 394
10. Hilfsmittel 399
10.1. Häufig verwendete Abkürzungen (Katharina Kagerer) 399
10.2. Abkürzungen für Nachweise der Bibelbücher (Christine Wulf) 409
10.3. Epigraphik im Internet (Max Grüntgens/Jürgen Herold/Thomas Kollatz/Markus Studer/Jörg Witzel) 411
Literaturverzeichnis 415
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 449