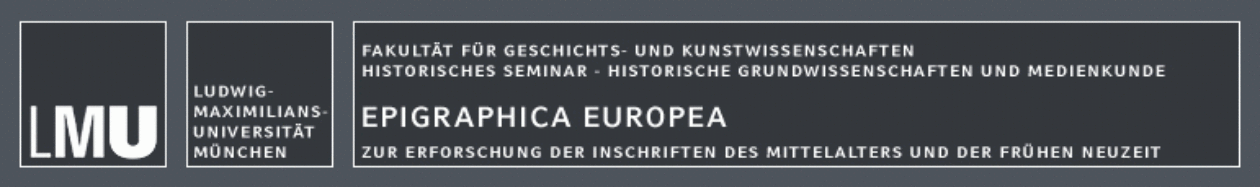Die Inschriften der Stadt Straubing, gesammelt und bearbeitet von Ramona Baltolu, Mirjam Goeth und Christine Steininger. Wiesbaden (Ludwig Reichert) 2025 (Die Deutschen Inschriften 119, Münchener Reihe 22). 672 S. sowie 77 Tafeln mit 184 s/w und 41 farbigen Abb., Ln. mit Schutzumschlag. ISBN: 978-3-7520-0881-4. EUR 98,–
Der Band widmet sich den Inschriften der Stadt Straubing in ihren heutigen Gemeindegrenzen. Erfasst wurden alle Inschriften bis zum Jahr 1650. Straubing als Zentrum des Gäubodens weist eine lange Siedlungstradition auf. Die mittelalterliche Inschriftenüberlieferung setzt um das Jahr 1300 ein. Das Ensemble um St. Peter in der Altstadt weist mit seinem historischen Friedhof eine große Zahl an
Grabdenkmälern aus dem Bereich des Handwerks und der städtischen Bürgerschaft auf. Neben der Sühnekapelle für Agnes Bernauer ist hier auch das Ensemble der Familiengrablege der Labermair/Dürnitzl an der Frauenkapelle von besonderem Interesse. Die Inschriftenbestände der Neustadt konzentrieren sich auf die heutige Pfarrkirche St. Jakob. Neben dem Totengedenken der Kleriker und Kapellen-stiftender Familien wird auch in einzelnen Bildfenstern, unter ihnen das einzigartige Mosesfenster, das Mäzenatentum der Bürgerschaft, aber auch von Bruderschaften sichtbar. Von besonderem Interesse ist die Kirchenneupflasterung 1614, bei der zahlreiche, ältere Grabplatten durch Bodenplättchen ersetzt wurden, die eine Fortführung des Gedenkens an die Stifter sicherstellen sollten. Ein weiteres Zentrum sind die Grablegen der Straubinger Oberschicht, zum Beispiel der Zeller und der später in den Adel aufgestiegenen Familien der Lerchenfelder, und der Nothafft in der Karmelitenkirche. Straubing weist mehrere bedeutende Steinmetzwerkstätten auf. Unter ihnen ist für das 15. Jahrhundert besonders Meister Erhard zu nennen. Daneben ist es in diesem Band gelungen, Werkstattzusammenhänge mit inschriftenpaläographischen Methoden fassbar zu machen (Verlagsanzeige).
Der Band wird am Donnerstag, 26. Juni 2025, um 19:00 Uhr
im Gäubodenmuseum, Fraunhoferstr. 23, in Straubing der Öffentlichkeit vorgestellt.
Dazu laden ein:
Prof. Dr. Markus Schwaiger, Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften München,
Prof. Dr. Bernd Päffgen, Vorsitzender des Ausschusses des Projektes für die Herausgabe der deutschen Inschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
München,
Historischer Verein für Straubing und Umgebung e.V.,
Ursula Reichert, Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden.
Der Band kann im Rahmen der Präsentation von den Mitgliedern der regionalen Geschichts- und Heimatvereine zum Sonderpreis von EUR 78,– vorbestellt werden.
Anmeldung per E-Mail: inschriftenkommission@di.badw.de (bis 20.06.2025)