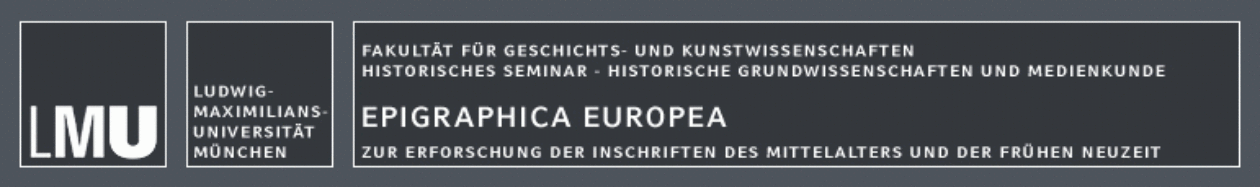Traversées. Limites, cheminements et créations en épigraphie, hg. von Vincent Debiais und Morgane Uberti, Pessac (Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, collection B@lades 3) 2024. 310 S. ISBN (html): 2-35311-158-0; ISBN (pdf): 2-35311-159-9
Traversées, eine Hybridpublikation aus wissenschaftlicher Synthese und Ausstellungskatalog, zeugt von einem Experiment der Begegnung zwischen Wissenschaft und zeitgenössischer Kunst rund um eine Quelle der Geschichte, die antike Inschrift, und ihre Disziplin, die Epigraphik. Das Buch zeichnet das Abenteuer nach, von den Fragen, die im Rahmen eines Forschungsprogramms zur spätantiken und mittelalterlichen Epigraphik an die Dokumentation gestellt wurden, bis hin zum Zusammenfluss von historischen und künstlerischen Erkundungen während der Ausstellung Sendas Epigraficas. Das epigraphische Objekt, das hier von den Forscherinnen und Forschern nach seinen chronologischen, materiellen und alphabetischen Rändern befragt wird, befreit sich vom Joch der Geschichte und wird zu einer Quelle der Inspiration für den Künstler. Die Zusammenstellung von wissenschaftlichen Artikeln, Werkbeschreibungen, kritischen Rezeptionen der Ausstellung und übergreifenden Abschnitten zeigt die Relevanz einer Verbindung von künstlerischen und historischen Praktiken, um die Inschrift und ihre Definitionen neu zu überdenken. Traversées ist ein inhaltlich und formal originelles Verlagsobjekt, das den Übergang zwischen Werk und Quelle, zwischen der Geste des Künstlers und der des Historikers ermöglicht, indem es die Wege variiert und in Resonanz zueinander steht. Die Publikation versucht somit, ein lebendiges Bild des Schaffensprozesses wie auch einer Wanderung durch einen Ausstellungsraum zu vermitteln und gleichzeitig zu freien Blicken auf die Inschrift zu verpflichten. Letztendlich stellt Traversées die Möglichkeit der Disziplinlosigkeit als Modalität der Erkenntnis in Frage (Verlagsanzeige; übersetzt aus dem Französischen mit DeepL.com)
Sendas epigráficas. L’épigraphie à l’épreuve du sensible (Fabienne Aguado, Laurent Callegarin), S. 7-9
Una novedosa y fecunda colaboración (Isabelle Velázquez), S. 11-17
Remerciements (Morgan Uberti), S. 19-20
Prémabule (Vincent Debiais, Morgane Uberti), S. 21-28
La collection épigraphique (Vincent Debiais), S. 29-30
La verbe émancipé (Pierre-Olivier Dittmar), S. 31-37
Matière
Marie Bonnin, Pruebas (Morgane Uberti, avec la collaboration de Marie Bonnin), S. 41-48
Iconicité et perception des tituli : matérialité et signification de l’écriture dans les mosaïques pariétales des églises (Ve-IXe siècle) (Elisabetta Neri), S. 49-71
L’écriture sigillaire au Moyen Âge (Ambre Vilain), S. 73-90
Sylvain Konyali, Paul Vergonjeanne, Impressions de matière de pierre (Morgane Uberti) S. 91-100
Formes sensibles anhistoriques, ou comment faire ɶvre à partir de sources épigraphiques (Francesca Cozzolino), S. 101-132
Signe
Naomi Melville, Relire, relier (Morgane Uberti, avec la collaboration de Naomi Melville), S. 135-142
Sens dessus-dessous (Coline Ruiz Darasse), S. 143-161
La possibilité d’une „iconisation“ de l’écriture au Moyen Âge (Brigitte Miriam Bedos-Rezak), S. 163-186
Naomi Melville, Renommer (Morgane Uberti, avec la collaboration de Naomi Melville), S. 187-192
El signo como trazo, el trazo como signo (Jaime Siles), S. 193-197
Temps
Sylvain Konyali, Auto-poème (Morgane Uberti, avec la collaboration de Sylvain Konyali), S. 201-205
When did „late antique epigraphy“ come to an end? (Christian Witschel), S. 207-238
Musa architectonica. La reinvención de la epigrafía monumental en verso entre los siglos IV y XII (Daniel Rico), S. 239-255
Giovanni Bertelli, Carlos de Castellarnau, Epifonías (Morgane Uberti, avec la collaboration de Giovanni Bertelli et Carlos de Castellarnau), S. 257-262
La recherche comme idéal de l’art, et inversement (Clovis Maillet), S. 263-270
Andrés Padilla Domene, Morgane Uberti, Inscriptions sauvages, domestication graphique (Morgane Uberti, avec la collaboration d’Andrés Padilla Domene), S. 271-279
Expérience intranquille : création contemporaine et pratiques historiennes (Vincent Debiais, Morgane Uberti), S. 281-307.