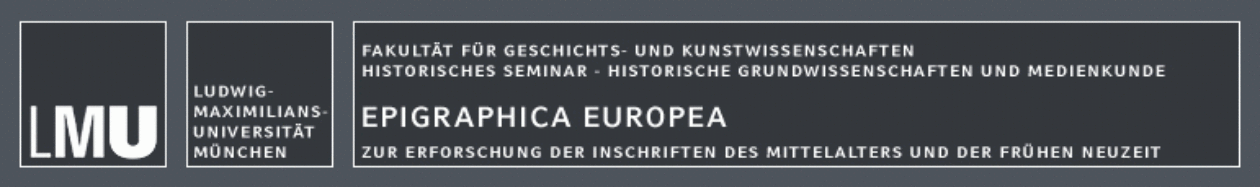Zum Auspapierln. Epigraphische Bonbons für Franz-Albrecht Bornschlegel anlässlich seines Ausscheidens aus dem Dienst, hrsg. von Ramona Baltolu, Christine Steininger, Martin Riebel. Archiv für Epigraphik 4, 2024.
Die epigraphische Festschrift enthält Beiträge von Kommissions-mitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der diversen Inschriftenarbeitsstellen der deutschen Akademien der Wissenschaften und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wie auch von Studentinnen und Studenten von Bornschlegels epigraphischen Lehrveranstaltungen an der LMU München. Die Beiträge der Festschrift sind in der elektronischen Fachzeitschrift „Archiv für Epigraphik“, Jahrgang 4 (2024) FS Bornschlegel online einsehbar (https://www.epigraphik.org/fs-bornschlegel/) (FB).
Ramona Baltolu / Christine Steininger, Vorwort, S. 5.
Bernd Päffgen, Publicus Frontinius Decoratus und die Stolata Iulia Sperata: Im Eisenerzbergbau tätige Augsburger Aristokraten der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Bemerkungen zu einer Sarkophag-Inschrift, S. 7-16.
Jan Ilas Bartusch, Zwei Zierinitialen an einem schwäbischen Kirchenbau. Zum Einfluss gotischer Schreibtradition auf die Steinmetzkunst in Oberlenningen (Lkr. Esslingen), S. 17-24.
Eberhard J. Nikitsch, Hildegard von Bingen und die Mächtigen, S. 25-31.
Rüdiger Fuchs, Ranking der Evangelisten auf Glocken? Ein Denkanstoß, S. 33-40.
Harald Drös, ET POST IN TERCIO ANNO. Beobachtungen zum „Weiterzählen“ von Jahren in Inschriften, S. 41-46.
Gertrude Mras, ERRARE HVMANVM EST, S. 47-55.
Jörg H. Lampe und Christine Wulf, Bairisch in Niedersachsen. Inschriften mit dialektalem „Migrationshintergrund“, S. 57-60.
Renate Kohn, Kein Loy Hering. Und: Versuch einer Neubewertung des Epitaphs Bischofs Georg von Slatkonia im Wiener Stephansdom, S. 61-70.
Maximilian Poschner, Überlieferungen mit Hirn. Zur Tumba für Konrad und Afra Hirn (heute) im Dom zu Augsburg, S. 71-78.
Ramona Baltolu, „Zwei sehr unterschiedliche und doch so ähnliche Grabmäler“. Oder: Was hat ein Straubinger Grabdenkmal mit Augsburg zu tun? S. 79-86.
Mara Hofstett, Aufsatzthema auf Wanderschaft. Eine Spur von Straubing nach Freising über Innsbruck nach Brixen, S. 87-97.
Jaros Lukas, Peutinger zwischen Antike und Renaissance, S. 99-105.
Susanne Kern und Michael Oberweis, „Gesegnet, der da kommt!“. Ein hebräischer Willkommensgruß als Inschrift am ehemaligen Pfarrhaus zu Leun (1604), S. 107-113.
Romedio Schmitz-Esser, Beda Venerabilis im Dreißigjährigen Krieg. Das Eggensteiner-Epitaph an der Thaurer Pfarrkirche und seine epigraphische Analyse, S. 115-125.
Christine Steininger, Ein Franz für den Franz. Zum Gedächtnismal des Johann Franz Eckher von Kapfing und Lichteneck (1757) im Freisinger Dom, S. 127-135.
Tanja Kohwagner-Nikolai, Frumentum Electorum. Von zauberhaften Engeln und selbstbewussten Frauen, S. 137-146.
Sonja Hermann, Die Schleifkanne des Paderborner Bäckeramts: spätes 19. Jahrhundert statt 1634? S. 147-154.
Friedrich Ulf Röhrer-Ertl, Serifen, der Franz und ich. Das älteste Epitaph von St. Anna in Augsburg – gefunden und verloren, S. 155-163.
Mirjam Goeth, Kopiale Überlieferung, S. 164-165 (EpSep 241009)
Schriftenverzeichnis von Dr. Franz-Albrecht Bornschlegel, S. 167-173.