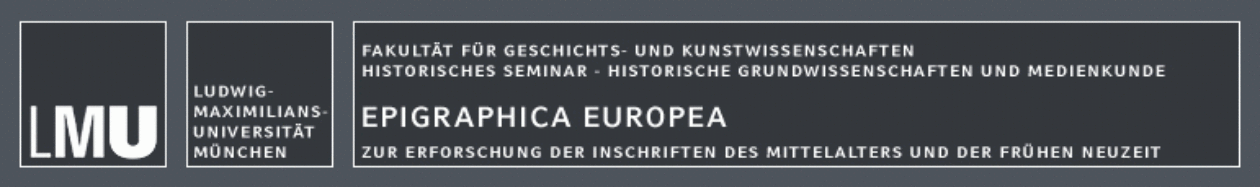Die Inschriften der Stadt Görlitz, gesammelt und bearbeitet von Sabine Zinsmeyer, Stephan Jödicke und Martin Riebel. Wiesbaden 2025 (Die Deutschen Inschriften 123, Leipziger Reihe 10). 928 S., 107 farb. Abb., 172 s/w Abb., 88 Tafeln mit 282 Abb. und 99 Steinmetzzeichen, Leinen mit Schutzumschlag, Bd. 1: 244 S., Bd. 2: 684 S. ISBN: 9783752009194, EUR 120.
Archiv der Kategorie: Allgemeines
Kern/Oberweis (Hgg.) – Epigraphische Festschrift Rüdiger Fuchs
Vulpes annosa non capitur. Festschrift für Rüdiger Fuchs zum 70. Geburtstag, hrsg. von Susanne Kern und Michael Oberweis. Leipzig 2025 (Archiv für Epigraphik 5,2)
Die Beiträge der epigraphischen Festschrift sind in der elektronischen Fachzeitschrift „Archiv für Epigraphik“, Jahrgang 5,2 (2025) FS Fuchs online einsehbar (https://www.epigraphik.org/fs-fuchs/) (FB).
Sarah Wieland, Schriftenverzeichnis Rüdiger Fuchs, S. 7-10
Sebastian Scholz, Das Epitaph des Bischof Liconcius von Lyon? Ein Rekonstruktionsversuch, S. 11-16
Klaus Frédéric Johannes, Bemerkungen zu Friedrich Barbarossa, S. 17-27
Jan Ilas Bartusch, Diepolds rätselhafte Grabschrift, S. 29-41
Gertrude Mras, Frühe deutschsprachige Inschriften. Ein skizzenhafter Versuch, 40 Jahre später, S. 43-52
Hartmut Scholz, Zufall – oder die Suche nach dem verborgenen Sinn, S. 53-62
Wolfgang Schmid, Wappen und Hausmarken: Konkurrierende Zeichensysteme – mit und ohne Schrift, S. 63-72 Wappen und Hausmarken
Steffen Krieb, Adelige Erinnerungskultur und Krankheit. Die Flersheimer Stifterinschrift im Wormser Kollegiatsstift St. Martin, S. 73-78
Eva-Maria Dickhaut, Das Gemäldeepitaph für Balthasar von Holtzendorff in der Marburger Elisabethkirche, S. 79-83
Stefan Heinz, Kapitale Erkenntnisse – oder in vier Zitaten zu Hoffmann, Haar und Rüdiger Fuchs, S. 85-92
Renate Kohn, Die Identifikation einer Schreibhauerhand über Schriftformgrenzen hinweg. Ein Fallbeispiel, S. 93-105
Susanne Kern und Michael Oberweis, Scaliger. Eine italienische Gelehrtenfamilie im Fokus der „Deutschen Inschriften“, S. 107-116
Christine Steininger, Fürnehme Herren in Niederbayern. Überlegungen zur Anwendung eines Epithetons, S. 117-121
Raoul Hippchen, etliche schöne begrebnissen vnnd epitaphia. Ein fürstlicher Brief zu den Grabdenkmälern in St. Arnual und eine bislang unbeachtete Sammlung nassauischer Inschriften, S. 123-138
Julia Noll, Ein spektakulärer Quellenneufund. C. Seibert und seine Zeichnungen von heute verlorenen Grabplatten aus der Marburger Elisabethkirche, S. 139-149
Edgar Siedschlag, Incisionis mnemosynon pium. Zur metrischen Analyse eines verderbt überlieferten Grabgedichts, S. 151-157
Uwe Gast, Zu Besuch im Gasthaus Zum goldenen Rindfuß in Nürnberg, S. 159-169
Ramona Baltolu, Eine ungewöhnliche Votivgabe in Sossau, S. 171-176
Wolfgang Müller, Impressionen zur Geschichte des Historischen Instituts der Universität des Saarlandes in den 60er Jahren, S. 177-186
Franz-Albrecht Bornschlegel, Die Erdbebeninschriften von Wombach und Gelnhausen. Eine epigraphische Gratwanderung, S. 187-195.
Zdrenka – Inscrypcje powiatu choszceńskiego (Corpus inscriptionum Poloniae 11,3)
Inscrypcje województwa zachodniopomorskiego, pod redakcją Joachima Zdrenki, 3: Inscrypcje powiatu choszceńskiego (do 1815 roku), zebrał i opracował Joachim Zdrenka (Corpus Inscriptionum Poloniae 11,3). Kraków (Wydawnictwo Avalon) 2025. 317 S. mit 151 s/w-Abb. ISBN: 978-83-7730-709-0. Zł 65,00 [Die Inschriften der Woiwodschaft Westpommerns, Lkr. Choszczno (Arnswalde)]
Der Inschriftenband umfasst 183 Katalognummern mit Inschriften von 1313 bis 1815. Von den 18 Inschriften bis zum Jahr 1500 liegen ausschließlich vier Glocken und ein Kruzifix in originaler Überlieferung vor. Wie bereits im Vorgängerband zu den Inschriften des Landkreises Myślibórz (Soldin) aus dem selben Jahr 2025 stellen die Glocken mit etwa 40 Prozent den größten Anteil am Inschriftenbestand dar. Weit abgeschlagen folgen die Totengedächtnismale (12%) sowie die Altarinschriften, Bauinschriften und Kelchinschriften (je 7-8%). (FB)
Schröder-Stapper – Die geschriebene Stadt
Teresa Schröder-Stapper, Die geschriebene Stadt. Inschriften als urbane Wissenspraxis vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. Göttingen (Wallstein Verlag GmbH) 2025 (Frühneuzeit-Forschungen 30). 594 S. mit 43 z.T. farb. Abbildungen. ISBN 978-3-8353-5801-0. EUR 49.
Wie beschrifteten Menschen in der Frühen Neuzeit ihre Häuser? Wie wurden Grabinschriften gestaltet? Teresa Schröder-Stapper untersucht vormoderne Inschriften erstmals mit Blick auf ihre Bedeutung als Ausdruck urbaner Wissenskulturen. Betrachtet man die zeitgenössischen Überreste frühneuzeitlicher Städte, so fällt auf, dass zahlreiche Texte, Bilder und Symbole das vormoderne Stadtbild prägten. Neben ephemerer Schriftlichkeit handelte es sich hierbei auch um Inschriften, die auf verschiedenen Materialträgern innerhalb der Stadt angebracht waren. In diesen Inschriften wurden unterschiedliche Wissensbestände artikuliert und in den Stadtraum eingeschrieben: Von juridischem über religiöses oder magisches Wissen bis hin zu technischem und Alltagswissen. In ihrer Studie versteht Teresa Schröder-Stapper frühneuzeitliche Inschriften sowohl als Ausdruck wie auch als Medium urbaner Wissenskulturen. Sie fragt nach den Funktionen von Inschriften innerhalb der Stadt sowie dem historischen Wandel, dem die darin eingeschriebenen Aussagen unterlagen. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der ordnungsstiftenden Bedeutung von Inschriften in einer vermeintlich unübersichtlichen Stadt. Im Zentrum ihres Erkenntnisinteresses stehen (Stadt-)Repräsentationen sowie deren Relevanz für das Handeln städtischer Akteure. Auf diese Weise nimmt Schröder-Stapper die Stadt als visuellen Erfahrungs- und Wahrnehmungsraum in den Blick. Am Beispiel der vormodernen Stadt leistet sie damit einen Beitrag zur Erforschung einer ‚Kultur der Sichtbarkeit‘ (Verlagsanzeige).
Zdrenka – Inscrypcje powiatu myśliborskiego (Corpus inscriptionum Poloniae 11,2)
Inscrypcje województwa zachodniopomorskiego, pod redakcją Joachima Zdrenki, 2: Inscrypcje powiatu myśliborskiego (do 1815 roku), zebrał i opracował Joachim Zdrenka (Corpus Inscriptionum Poloniae 11,2). Kraków (Wydawnictwo Avalon) 2025. 204 S. mit 78 s/w-Abb. ISBN: 978-83-7730-694-9. Zł 65,00 [Die Inschriften der Woiwodschaft Westpommerns, Lkr. Myślibórz (Soldin)]
Diese Ausgabe ist die zweite, die im Rahmen des Forschungsprojekts der Reihe Corpus Inscriptionum Poloniae, Band XI, veröffentlicht wird. In der ersten Phase (bis 2027) soll das Projekt fünf zeitgenössische Gespanschaften abdecken: 1. Gryfino (Teil des ehemaligen Komitats Chojeński) [2024 erschienen]; 2. Myśliborski; 3. Choszczeński; 4. Drawski und 5. Świdwiński – im historischen Sinne die Gebiete der ehemaligen Neuen Mark. Es ist das Ergebnis von Forschungen, die vom Epigraphischen Labor des Instituts für Geschichte der Universität Zielona Góra in den Jahren 2022-2024 durchgeführt wurden. Dieses Institut ist das einzige in Polen, das umfassende epigraphische Forschungen durchführt (Verlagsanzeige).
Der Inschriftenband umfasst 139 Katalognummern mit Inschriften von der 2. Hälfte des 13. Jh. bis 1815. Nur sieben Inschriften liegen bis zum Jahr 1500 vor, wovon ausschließlich vier Glocken original überliefert sind. Insgesamt haben sich nur mehr knapp 30 Prozent der Inschriften erhalten, über 70 Prozent gehen auf kopiale Überlieferungen (Abschriften oder Fotos) zurück. Die deutsche Sprache tritt bald nach 1550 in Grabinschriften auf und dominiert bis zum Ende des Bearbeitungszeitraums über die lateinische Sprache. Es liegen keine polnischen Inschriften vor. Der Band schließt mit einem ausführlichen Register (Standorte, Personen, Künstler/ Meister/ Werkstätten, Initialen und Monogramme, Wappen, Bibelzitate und liturgische Texte, Inschriftenträger, Sprache und Schriftarten, Berufe und Material, Heilige und biblische Personen/ Allegorie/ Mythologie/ Ikonographie, deutsch-polnische und polnisch-deutsche Liste von Ortsnamen) (FB).
Giersiepen/Stieldorf (Hgg.) – Epigraphik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Eine Einführung
Epigraphik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Eine Einführung, hg. von Helga Giersiepen und Andrea Stieldorf unter Mitarbeit von Sonja Hermann, Franz Jäger, Susanne Kern, Christine Magin und Ulrike Spengler-Reffgen. Wiesbaden (Reichert) 2025. ISBN: 9783752006216. EUR 59,-
Aus der über Jahrzehnte erwachsenen Expertise in der Epigraphik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes „Die Deutschen Inschriften“ ein Lehrbuch der Epigraphik erstellt, das sich sowohl an Studierende als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen und ebenso an interessierte „Nichtfachleute“ richtet. Vermittelt wird Basiswissen zu Materialien und Techniken, die für die Herstellung von Inschriften verwendet werden, die Sprachen, in denen die im Projekt bearbeiteten Inschriften verfasst sind, die wichtigsten Texttypen mit ihren Inhalten und Funktionen, zu den Quellen, aus denen bei der Abfassung von Inschriftentexten geschöpft wurde, und über den Umgang mit der kopialen Überlieferung. Die spezifisch epigraphische Expertise entfaltet sich im Kap. 7 in den Beschreibungen der Schriften. Daran schließen sich noch eine Anleitung zur Erfassung und Edition von Inschriften sowie ein größeres Kapitel zur digitalen Epigraphik an. Am Schluss folgen einige Hilfsmittel (Verlagsanzeige).
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 13
1. Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 17
1.1. Inschriften als Quellen (Helga Giersiepen) 17
1.2. Wissenschaftsgeschichte (Andreas Zajic) 23
2. Material und Technik 41
2.1. Inschriften in Stein 41
2.1.1. Naturstein – Bearbeitung – Schrifthauen (Philipp Stastny/Renate Kohn) 41
2.1.2. Steinätzplatten (Christine Steininger) 46
2.2. Inschriften in Metall I: Goldschmiedekunst (Jitka Ehlers) 50
2.3. Inschriften in Metall II: Bronze- und Messingguss, Eisenguss, Inschriften in Blei (Jörg H. Lampe) 61
2.4. Inschriften auf Textilien (Gudrun Sporbeck) 73
2.5. Inschriften in der Glasmalerei (Maria Deiters) 85
2.6. Inschriften in der Wandmalerei (Susanne Kern) 93
2.7. Inschriften aus Holz (Franz Jäger) 103
3. Die Sprache der Inschriften 109
3.1. Mittel- und Neulatein (Jens Borchert-Pickenhan/Mona Dorn) 109
3.2. Deutsch 115
3.2.1. Hochdeutsch (Hans Ulrich Schmid) 115
3.2.2. Niederdeutsch (Christine Wulf) 124
3.3. Griechisch (Henning Ohst) 129
3.4. Hebräisch (Michael Oberweis) 134
4. Texte: Inhalte und Funktionen 143
4.1. Inschriften des Totengedenkens (Franz Jäger) 144
4.2. Stifter-, Stiftungs-, Schenkungs- und Auftraggebervermerke (Ulrike Spengler-Reffgen) 159
4.3. Bildbeischriften: Inschriften zwischen Text und Bild (Kristine Weber) 169
4.4. Künstlersignatur/Meistersignatur und andere Formen der Urheberschaft (Susanne Kern) 184
4.5. Bauinschriften (Gertrude Mras) 191
4.6. Historische Nachrichten (Gertrude Mras) 198
4.7. Rechtsinschriften 205
4.7.1. Urkundeninschriften (Martin Riebel) 205
4.7.2. Sonstige Rechtsinschriften (Christine Magin) 209
4.8. Inschriften auf Glocken (Cornelia Neustadt/Jan Ilas Bartusch) 214
4.9. Graffiti (Sonja Hermann) 225
5. Textvorlagen 237
5.1. Bibel (Christine Wulf) 238
5.2. Liturgie (Ulrike Spengler-Reffgen) 245
5.3. Antike, mittelalterliche und frühneuzeitliche Autoren (Jens Borchert-Pickenhan) 255
6. Kopiale Überlieferung (Renate Kohn) 265
7. Entwicklung der epigraphischen Schriftarten 277
7.1. Vorkarolingische Kapitalis (Eberhard J. Nikitsch) 278
7.2. Kapitalisschriften von der Karolingerzeit bis um das Jahr 1000 (Karolingische Kapitalis und Frühe Kapitalis) (Rüdiger Fuchs) 290
7.3. Romanische Majuskel (Helga Giersiepen) 302
7.4. Gotische Majuskel (Rüdiger Fuchs) 310
7.5. Gotische Minuskel (Christine Magin/Christine Wulf) 320
7.6. Frühhumanistische Kapitalis (Andreas Zajic) 327
7.7. Renaissance-Kapitalis und Kapitalis der Frühen Neuzeit (Franz-Albrecht Bornschlegel) 335
7.8. Fraktur (Renate Kohn) 343
7.9. Humanistische Minuskel (Hans Fuhrmann) 351
7.10. Gotico-Antiqua (Ramona Baltolu) 358
7.11. Ziffern (Katharina Kagerer) 363
7.12. Interpunktionszeichen und Worttrenner (Eberhard J. Nikitsch) 366
7.13. Glossar zum Kapitel „Entwicklung der epigraphischen Schriftarten“ (Sonja Hermann) 371
8. Erfassung und Edition von Inschriften (Stefan Heinz/Raoul Hippchen) 375
9. Digitale Epigraphik 385
9.1. Zu den Anfängen der digitalen Epigraphik (Jörg Witzel) 385
9.2. EpiDoc und Normdaten (Thomas Kollatz/Markus Studer) 386
9.3. Datenmodellierung und Modellbildung (Max Grüntgens) 387
9.4. Spatial Humanities (Maximilian Kopp/Torsten Schrade/Markus Studer) 391
9.5. Linked Open Data und Knowledge Graphs (Max Grüntgens/ Torsten Schrade) 394
10. Hilfsmittel 399
10.1. Häufig verwendete Abkürzungen (Katharina Kagerer) 399
10.2. Abkürzungen für Nachweise der Bibelbücher (Christine Wulf) 409
10.3. Epigraphik im Internet (Max Grüntgens/Jürgen Herold/Thomas Kollatz/Markus Studer/Jörg Witzel) 411
Literaturverzeichnis 415
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 449
Giovè Marchioli/La Rocca/Zorzi – Veneto: Padova e Rovigo, 1 (Inscriptiones Medii Aevi Italiae 6)
Nicoletta Giovè Marchioli, Maria Cristina La Rocca, Niccolò Zorzi, Veneto – Padova e Rovigo, I. Spoleto (Fondazione Centro Italiano di studi sull’alto Medioevo) 2025 (Inscriptiones Medii Aevi Italiae 6). ISBN: 978-88-6809-448-5. EUR 25,-
Der Band, herausgegeben von Nicoletta Giovè Marchioli, Maria Cristina La Rocca und Niccolò Zorzi von der Universität Padua, ist der sechste in der Reihe der Inscriptiones Medii Aevi Italiae (IMAI) und der erste von zweien, die den griechischen und lateinischen Ingraphen der Provinzen Padua und Rovigo gewidmet sind: Er enthält die historische Einleitung, die paläographische Einleitung, die Karten der griechischen Ingraphen, die Bibliographie und die Verzeichnisse der beiden allgemeinen Einführungen. und speziell auf griechische Karten. Es folgt der zweite Band mit den Karten der lateinischen Inschriften und mit der Bibliographie und den relativen Verzeichnissen. Die historische Einführung von Maria Cristina La Rocca ermöglicht es uns, den politischen, institutionellen und wirtschaftlichen Rahmen der Provinzen Padua und Rovigo im weiteren Kontext Venetiens und Nordostitaliens zu klären. In der paläographischen Einleitung analysiert Nicoletta Giovè Marchioli detailliert die epigraphischen Zeugnisse in lateinischer Schrift, von denen die meisten aus der letzten Phase des von den IMAI abgedeckten Zeitraums stammen. Die Einträge von Niccolò Zorzi bieten eine eingehende Analyse der griechischen Inschriften, eines Korpus, das trotz seiner Kleinheit durch eine bemerkenswerte Heterogenität gekennzeichnet ist, die sich im Übrigen leicht durch die Vielfalt der Chronologie und die Art des Materials erklären lässt, auf dem die Inschriften angebracht sind (Verlagsanzeige).
Inschriften als Quellen der Kulturgeschichte des Ma. und der Frühen Nz. – Bonn, 17.09.25
Noll/Dickhaut – Die Inschriften der Elisabethkirche in Marburg (DI 121)
Die Inschriften der Elisabethkirche in Marburg, gesammelt und bearbeitet von Julia Noll, unter Mitarbeit von Eva-Maria Dickhaut (Die Deutschen Inschriften 121, Mainzer Reihe 7). Wiesbaden (Ludwig Reichert) 2025. 360 S., 77 Tafeln mit 260 Abb., Ln. mit Schutzumschlag. ISBN: 978-37520-0891-3. EUR 62,-
Inschriften auf Papier – Call for papers
Call for papers
Inschriften auf Papier. Gedruckte und handschriftliche Inschriften-
sammlungen in Europa vom 15. bis 20. Jahrhundert (Arbeitstitel)
INSCHRIFTEN SIND ÜBERLIEFERUNGSWÜRDIG. Diese banale Wahrheit ist keineswegs eine Erfindung der modernen Wissenschaft. Die epigraphischen Großprojekte, wie „Corpus Inscriptionum Latinarum“ oder „Die Deutschen Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ haben das Sammeln und Bearbeiten solcher Texte systematisiert und wissenschaftlich geformt, der Ursprung dessen kann aber mehrere hundert Jahre früher beobachtet werden. Bereits im Spätmittelalter setzte eine Entwicklung ein, die inschriftlichen Texten eine Bedeutung beimaß, diese sammelte und in teils umfangreichen Drucken der Nachwelt zur Verfügung stellte. Eine gewichtige Rolle spielten hierbei die humanistischen Gelehrten des 16. Jahrhunderts. 1) Besonders die Arbeit an den Bänden der „Deutschen Inschriften“ zeigt allerdings auch, dass Sammlungen nicht nur im Umfeld humanistischer Gelehrter entstanden, sondern sich im Laufe der Frühen Neuzeit immer weitere Personenkreise, wie Geistliche, Bürger oder Ratsangehörige aufmerksam durch „ihre“ Städte, Kirchen und ländlichen Räume bewegten und inschriftliche Texte von Grabmälern, Hausfassaden oder Eingangsportalen abschrieben. Die Überlieferung ist außerordentlich vielfältig und in der Forschung noch nicht in umfassendem Maße abgebildet. Der geplante Sammelband soll gedruckte und handschriftliche Inschriftensammlungen ab dem 15./16. Jahrhundert daher in ihrer Gesamtheit in den Blick nehmen. Ziel des Projekts ist es, einen
Überblick zur Entstehung, zum Kontext und zur Bedeutung der Inschriftensammlungen sowie zu den Sammlern zu erarbeiten. Der Band soll den Beginn tiefgreifender Forschungen mit dem Thema bilden. Geplant ist eine Veröffentlichung als Themenheft im „Archiv für Epigraphik“ für den Jahrgang 2026 als Online-Format. Mit diesem Aufruf wird für ein Einreichen entsprechender Beiträge geworben. Das Projekt versteht sich dabei ausdrücklich als epochenübergreifend, es soll nicht zwischen antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Inschriften unterschieden oder getrennt werden. Als Leitfragen werden vorgeschlagen: Wann entstehen solche Sammlungen und in welchen Kontexten? Gibt es regionale zeitliche Unterschiede? Wer sind die Sammler? Welchen biographischen Hintergrund haben sie? Welche Arten von Texten werden aufgeschrieben (inhaltlich, sprachlich)? In welchem Umfang wurde gesammelt? Galt das Interesse vorrangig repräsentativen Objekten oder verzeichnete man die Überlieferung ganzheitlich? Verfasste man reine Sammlungen oder integrierte man Nachweise in anderen Gattungen, wie bspw. Chroniken? Wie wurden die Texte übertragen, in einer einfachen inhaltlichen Wiedergabe oder versuchte man Inschrift und Träger in ihrer Gestaltung abzubilden (Nachahmung der Schriftart; Umzeichnung des Trägers)? Wie glaubwürdig bzw. zuverlässig sind die Kopisten? Nahm man die Objekte selbst in Augenschein oder schrieb man andere Kopisten ab? Handelt es sich um für die Öffentlichkeit bestimmte Drucke oder um archivalisch überlieferte Handschriften aus Nachlässen? Welche Bedeutung haben Kopisten für die heutige Kenntnis inschriftlicher Überlieferung in einer Region oder an einem Ort bzw. in welcher Weise haben sie die Überlieferung geprägt und beeinflusst?
1) Andreas Zajic, Inventionen und Intentionen eines gelehrten Genres. Gedruckte Inschriftensammlungen des 16. und frühen
17. Jahrhunderts; mit exemplarischen Glossen zur Praxis (epigraphischer) Gelegenheitsdichtung des Adels in der frühen Neuzeit, in: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext (Vorträge der 11. Internationalen Fachtagung für Epigraphik, Greifswald 9.–12.5.2007), hrsg. von / ed. by Christine Magin, Ulrich Schindel, Christine Wulf, Wiesbaden 2008, S. 165–192.
Um Themenvorschläge wird bis zum 31. August 2025 gebeten; um die verschriftlichten Beiträge bis zum 30. April 2026. Beiträge können inhaltlich aus dem gesamten europäischen Forschungs-
raum eingereicht werden; als Wissenschaftssprachen wird um Deutsch oder Englisch gebeten.
Dr. des. Thomas Rastig
Archiv für Epigraphik / Redakteur und Mitherausgeber / co-editor
Sächsische Akademie der Wissenschaften / Wissenschaftlicher Mitarbeiter / research associate
rastig@saw-leipzig.de
www.epigraphik.org
Call for papers
Inscriptions on Paper. Printed and Manuscript Collections of Inscriptions in Europe from the 15th to the 20th Century (working title) INSCRIPTIONS ARE WORTHY OF PRESERVATION. This seemingly self-evident truth is by no means a product of modern scholarship. Major epigraphic projects such as the „Corpus Inscriptionum Latinarum“ and „Die Deutschen Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ have systematised and shaped the collection and academic treatment of such texts. However, the origins of this practice can be traced back several centuries earlier. Already in the late Middle Ages, people began to attribute significance to inscribed texts, collect them, and make them available to posterity through often extensive printed editions.
Humanist scholars of the 16th century played a key role in this process.1) Work on the volumes of „Die Deutschen Inschriften“ has shown, that such collections did not originate solely within the
circles of humanist scholars. Over the course of the Early Modern period, an increasingly broad range of individuals – including clergy, townspeople, and members of municipal councils – began to move attentively through their cities, churches, and rural areas, copying inscribed texts from tombstones, house façades, and entrance portals. The transmission of these texts is extraordinarily diverse and has yet to be comprehensively represented. The planned edited volume aims to provide a comprehensive examination of printed and manuscript collections of inscriptions from the 15th/16th century onwards. The objective of the project is to offer an overview of the origins, contexts, and significance of these collections, as well as of the individuals who compiled them. The volume is intended to serve as a starting point for in-depth research into this subject. Publication is planned as a thematic issue of „Archiv für Epigraphik“ (2026 volume), to be published in an online format. This call invites the submission of suitable contributions. The project explicitly adopts a transpochal approach: no distinction or separation is to be made between ancient, medieval, and early modern inscriptions. The following guiding questions are proposed: When did such collections emerge, and in what contexts? Are there regional or chronological variations? Who were the collectors, and what were their biographical backgrounds? What types of texts were recorded (in terms of content and language)? What was the scope of the collections? Was the focus primarily on prestigious objects, or was the transmission documented in a more comprehensive manner? Were independent collections compiled, or were inscriptions integrated into other genres, such as chronicles? How were the texts transcribed – as simple reproductions of content, or with attempts to capture the form and design of the inscriptions and their material supports (e.g. imitation of script styles; drawings or tracings of the inscribed objects)? How credible or reliable were the copyists? Did they examine the objects directly, or were their copies based on other sources? Were the resulting collections intended for publication, or are they archival manuscripts preserved in private or institutional holdings? What is the significance of these copyists for our current understanding of epigraphic transmission in a given region or locality, and in what ways did they shape or influence that transmission?
Proposals for contributions are requested by 31 August 2025, with final submissions of written articles due by 30 April 2026. Contributions may address material from across the European area.
Articles may be submitted in either German or English.
1) Andreas Zajic, Inventionen und Intentionen eines gelehrten Genres. Gedruckte Inschriftensammlungen des 16. und frühen
17. Jahrhunderts; mit exemplarischen Glossen zur Praxis (epigraphischer) Gelegenheitsdichtung des Adels in der frühen Neuzeit, in: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext (Vorträge der 11. Internationalen Fachtagung für Epigraphik, Greifswald 9.–12.5.2007), hrsg. von / ed. by Christine Magin, Ulrich Schindel, Christine Wulf, Wiesbaden 2008, S. 165–192.
Dr. des. Thomas Rastig
Archiv für Epigraphik / Redakteur und Mitherausgeber / co-editor
Sächsische Akademie der Wissenschaften / Wissenschaftlicher Mitarbeiter / research associate
rastig@saw-leipzig.de
www.epigraphik.org