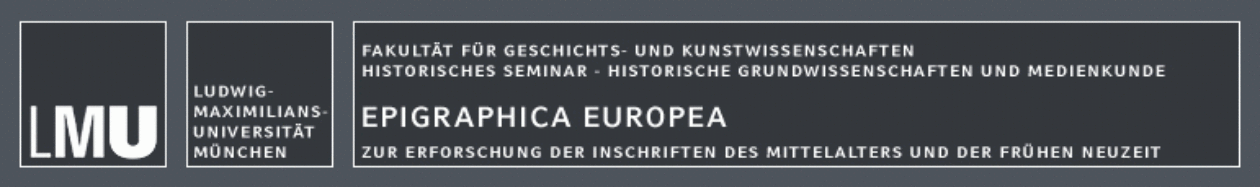Call for papers
Inschriften auf Papier. Gedruckte und handschriftliche Inschriften-
sammlungen in Europa vom 15. bis 20. Jahrhundert (Arbeitstitel)
INSCHRIFTEN SIND ÜBERLIEFERUNGSWÜRDIG. Diese banale Wahrheit ist keineswegs eine Erfindung der modernen Wissenschaft. Die epigraphischen Großprojekte, wie „Corpus Inscriptionum Latinarum“ oder „Die Deutschen Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ haben das Sammeln und Bearbeiten solcher Texte systematisiert und wissenschaftlich geformt, der Ursprung dessen kann aber mehrere hundert Jahre früher beobachtet werden. Bereits im Spätmittelalter setzte eine Entwicklung ein, die inschriftlichen Texten eine Bedeutung beimaß, diese sammelte und in teils umfangreichen Drucken der Nachwelt zur Verfügung stellte. Eine gewichtige Rolle spielten hierbei die humanistischen Gelehrten des 16. Jahrhunderts. 1) Besonders die Arbeit an den Bänden der „Deutschen Inschriften“ zeigt allerdings auch, dass Sammlungen nicht nur im Umfeld humanistischer Gelehrter entstanden, sondern sich im Laufe der Frühen Neuzeit immer weitere Personenkreise, wie Geistliche, Bürger oder Ratsangehörige aufmerksam durch „ihre“ Städte, Kirchen und ländlichen Räume bewegten und inschriftliche Texte von Grabmälern, Hausfassaden oder Eingangsportalen abschrieben. Die Überlieferung ist außerordentlich vielfältig und in der Forschung noch nicht in umfassendem Maße abgebildet. Der geplante Sammelband soll gedruckte und handschriftliche Inschriftensammlungen ab dem 15./16. Jahrhundert daher in ihrer Gesamtheit in den Blick nehmen. Ziel des Projekts ist es, einen
Überblick zur Entstehung, zum Kontext und zur Bedeutung der Inschriftensammlungen sowie zu den Sammlern zu erarbeiten. Der Band soll den Beginn tiefgreifender Forschungen mit dem Thema bilden. Geplant ist eine Veröffentlichung als Themenheft im „Archiv für Epigraphik“ für den Jahrgang 2026 als Online-Format. Mit diesem Aufruf wird für ein Einreichen entsprechender Beiträge geworben. Das Projekt versteht sich dabei ausdrücklich als epochenübergreifend, es soll nicht zwischen antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Inschriften unterschieden oder getrennt werden. Als Leitfragen werden vorgeschlagen: Wann entstehen solche Sammlungen und in welchen Kontexten? Gibt es regionale zeitliche Unterschiede? Wer sind die Sammler? Welchen biographischen Hintergrund haben sie? Welche Arten von Texten werden aufgeschrieben (inhaltlich, sprachlich)? In welchem Umfang wurde gesammelt? Galt das Interesse vorrangig repräsentativen Objekten oder verzeichnete man die Überlieferung ganzheitlich? Verfasste man reine Sammlungen oder integrierte man Nachweise in anderen Gattungen, wie bspw. Chroniken? Wie wurden die Texte übertragen, in einer einfachen inhaltlichen Wiedergabe oder versuchte man Inschrift und Träger in ihrer Gestaltung abzubilden (Nachahmung der Schriftart; Umzeichnung des Trägers)? Wie glaubwürdig bzw. zuverlässig sind die Kopisten? Nahm man die Objekte selbst in Augenschein oder schrieb man andere Kopisten ab? Handelt es sich um für die Öffentlichkeit bestimmte Drucke oder um archivalisch überlieferte Handschriften aus Nachlässen? Welche Bedeutung haben Kopisten für die heutige Kenntnis inschriftlicher Überlieferung in einer Region oder an einem Ort bzw. in welcher Weise haben sie die Überlieferung geprägt und beeinflusst?
1) Andreas Zajic, Inventionen und Intentionen eines gelehrten Genres. Gedruckte Inschriftensammlungen des 16. und frühen
17. Jahrhunderts; mit exemplarischen Glossen zur Praxis (epigraphischer) Gelegenheitsdichtung des Adels in der frühen Neuzeit, in: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext (Vorträge der 11. Internationalen Fachtagung für Epigraphik, Greifswald 9.–12.5.2007), hrsg. von / ed. by Christine Magin, Ulrich Schindel, Christine Wulf, Wiesbaden 2008, S. 165–192.
Um Themenvorschläge wird bis zum 31. August 2025 gebeten; um die verschriftlichten Beiträge bis zum 30. April 2026. Beiträge können inhaltlich aus dem gesamten europäischen Forschungs-
raum eingereicht werden; als Wissenschaftssprachen wird um Deutsch oder Englisch gebeten.
Dr. des. Thomas Rastig
Archiv für Epigraphik / Redakteur und Mitherausgeber / co-editor
Sächsische Akademie der Wissenschaften / Wissenschaftlicher Mitarbeiter / research associate
rastig@saw-leipzig.de
www.epigraphik.org
Call for papers
Inscriptions on Paper. Printed and Manuscript Collections of Inscriptions in Europe from the 15th to the 20th Century (working title) INSCRIPTIONS ARE WORTHY OF PRESERVATION. This seemingly self-evident truth is by no means a product of modern scholarship. Major epigraphic projects such as the „Corpus Inscriptionum Latinarum“ and „Die Deutschen Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ have systematised and shaped the collection and academic treatment of such texts. However, the origins of this practice can be traced back several centuries earlier. Already in the late Middle Ages, people began to attribute significance to inscribed texts, collect them, and make them available to posterity through often extensive printed editions.
Humanist scholars of the 16th century played a key role in this process.1) Work on the volumes of „Die Deutschen Inschriften“ has shown, that such collections did not originate solely within the
circles of humanist scholars. Over the course of the Early Modern period, an increasingly broad range of individuals – including clergy, townspeople, and members of municipal councils – began to move attentively through their cities, churches, and rural areas, copying inscribed texts from tombstones, house façades, and entrance portals. The transmission of these texts is extraordinarily diverse and has yet to be comprehensively represented. The planned edited volume aims to provide a comprehensive examination of printed and manuscript collections of inscriptions from the 15th/16th century onwards. The objective of the project is to offer an overview of the origins, contexts, and significance of these collections, as well as of the individuals who compiled them. The volume is intended to serve as a starting point for in-depth research into this subject. Publication is planned as a thematic issue of „Archiv für Epigraphik“ (2026 volume), to be published in an online format. This call invites the submission of suitable contributions. The project explicitly adopts a transpochal approach: no distinction or separation is to be made between ancient, medieval, and early modern inscriptions. The following guiding questions are proposed: When did such collections emerge, and in what contexts? Are there regional or chronological variations? Who were the collectors, and what were their biographical backgrounds? What types of texts were recorded (in terms of content and language)? What was the scope of the collections? Was the focus primarily on prestigious objects, or was the transmission documented in a more comprehensive manner? Were independent collections compiled, or were inscriptions integrated into other genres, such as chronicles? How were the texts transcribed – as simple reproductions of content, or with attempts to capture the form and design of the inscriptions and their material supports (e.g. imitation of script styles; drawings or tracings of the inscribed objects)? How credible or reliable were the copyists? Did they examine the objects directly, or were their copies based on other sources? Were the resulting collections intended for publication, or are they archival manuscripts preserved in private or institutional holdings? What is the significance of these copyists for our current understanding of epigraphic transmission in a given region or locality, and in what ways did they shape or influence that transmission?
Proposals for contributions are requested by 31 August 2025, with final submissions of written articles due by 30 April 2026. Contributions may address material from across the European area.
Articles may be submitted in either German or English.
1) Andreas Zajic, Inventionen und Intentionen eines gelehrten Genres. Gedruckte Inschriftensammlungen des 16. und frühen
17. Jahrhunderts; mit exemplarischen Glossen zur Praxis (epigraphischer) Gelegenheitsdichtung des Adels in der frühen Neuzeit, in: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext (Vorträge der 11. Internationalen Fachtagung für Epigraphik, Greifswald 9.–12.5.2007), hrsg. von / ed. by Christine Magin, Ulrich Schindel, Christine Wulf, Wiesbaden 2008, S. 165–192.
Dr. des. Thomas Rastig
Archiv für Epigraphik / Redakteur und Mitherausgeber / co-editor
Sächsische Akademie der Wissenschaften / Wissenschaftlicher Mitarbeiter / research associate
rastig@saw-leipzig.de
www.epigraphik.org