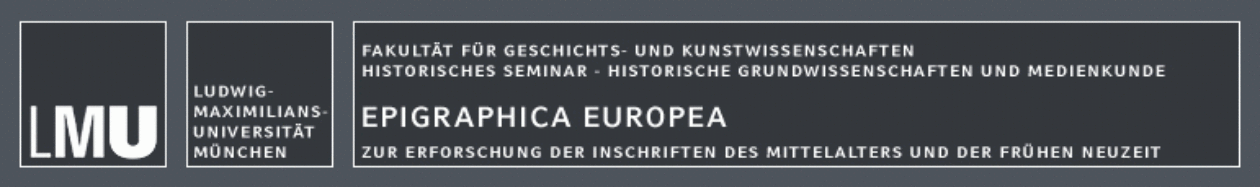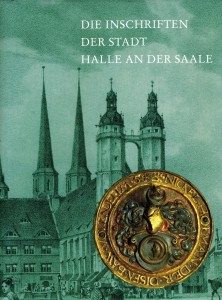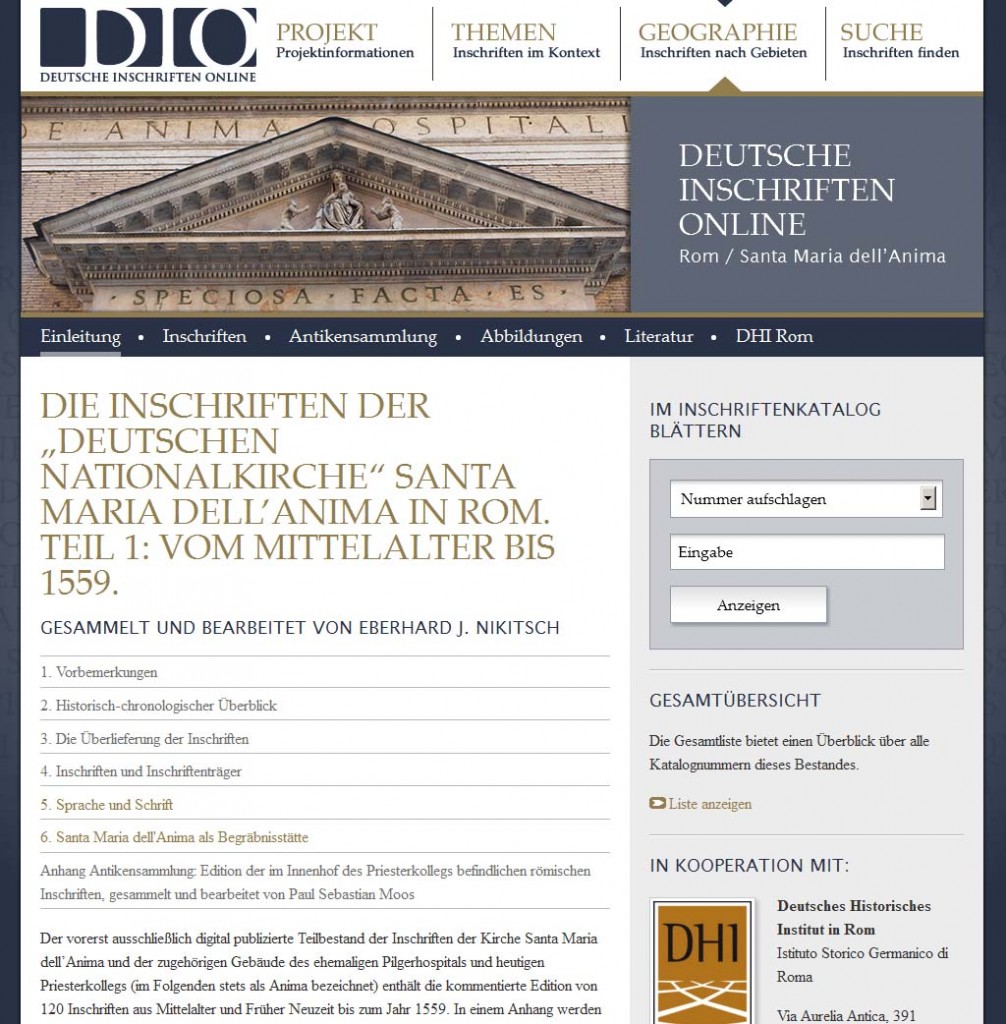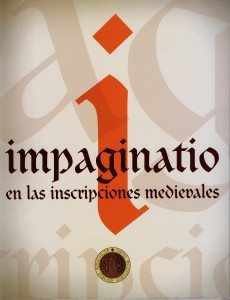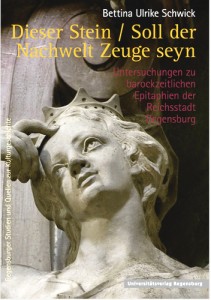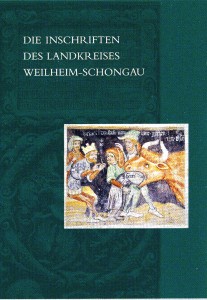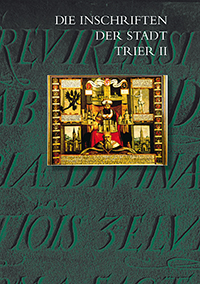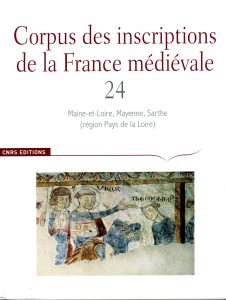12. Fachtagung zur Problematik der Sepulkraldenkmäler
Prag, 31. Oktober – 1. November 2013
Institut für Kunstgeschichte, Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik
Akademisches Tagungszentrum, Husova 6, Praha 1
12. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, 31. října – 1. listopadu 2013 (doplnění programu)
Akademické konferenční centrum, Husova 6, Praha 1
Periodické konference k problematice sepulkrálních památek pořádá s mezinárodní účastí Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. od roku 2000. Hlavním cílem je umožnit kontakt zainteresovaných zástupců všech s problematikou souvisejících disciplín (dějin umění, historie, archeologie, epigrafiky, heraldiky, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity přístupu ke zpracování materiálu a koordinace dosud rozptýleného bádání. Příspěvky zasedání jsou publikovány v řadě Epigraphica et Sepulcralia nakladatelství ÚDU AV ČR Artefactum. Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání námětu na vystoupení (název příspěvku a stručné resumé). Délka příspěvku se předpokládá 20 minut, přihlásit lze rovněž zprávy v trvání do max. 10 minut. Nově lze přihlašivat i postery! Vystoupení se mohou věnovat jakémukoliv aspektu uvedené problematiky, jediným omezením je věcný či metodický vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí.
Návrhy zasílejte prosím do 15. března 2013 na níže uvedenou adresu, kde je možné získat i upřesňující informace.