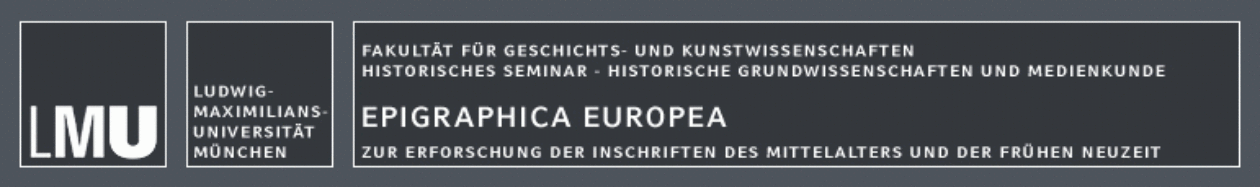Vulpes annosa non capitur. Festschrift für Rüdiger Fuchs zum 70. Geburtstag, hrsg. von Susanne Kern und Michael Oberweis. Leipzig 2025 (Archiv für Epigraphik 5,2)
Die Beiträge der epigraphischen Festschrift sind in der elektronischen Fachzeitschrift „Archiv für Epigraphik“, Jahrgang 5,2 (2025) FS Fuchs online einsehbar (https://www.epigraphik.org/fs-fuchs/) (FB).
Sarah Wieland, Schriftenverzeichnis Rüdiger Fuchs, S. 7-10
Sebastian Scholz, Das Epitaph des Bischof Liconcius von Lyon? Ein Rekonstruktionsversuch, S. 11-16
Klaus Frédéric Johannes, Bemerkungen zu Friedrich Barbarossa, S. 17-27
Jan Ilas Bartusch, Diepolds rätselhafte Grabschrift, S. 29-41
Gertrude Mras, Frühe deutschsprachige Inschriften. Ein skizzenhafter Versuch, 40 Jahre später, S. 43-52
Hartmut Scholz, Zufall – oder die Suche nach dem verborgenen Sinn, S. 53-62
Wolfgang Schmid, Wappen und Hausmarken: Konkurrierende Zeichensysteme – mit und ohne Schrift, S. 63-72 Wappen und Hausmarken
Steffen Krieb, Adelige Erinnerungskultur und Krankheit. Die Flersheimer Stifterinschrift im Wormser Kollegiatsstift St. Martin, S. 73-78
Eva-Maria Dickhaut, Das Gemäldeepitaph für Balthasar von Holtzendorff in der Marburger Elisabethkirche, S. 79-83
Stefan Heinz, Kapitale Erkenntnisse – oder in vier Zitaten zu Hoffmann, Haar und Rüdiger Fuchs, S. 85-92
Renate Kohn, Die Identifikation einer Schreibhauerhand über Schriftformgrenzen hinweg. Ein Fallbeispiel, S. 93-105
Susanne Kern und Michael Oberweis, Scaliger. Eine italienische Gelehrtenfamilie im Fokus der „Deutschen Inschriften“, S. 107-116
Christine Steininger, Fürnehme Herren in Niederbayern. Überlegungen zur Anwendung eines Epithetons, S. 117-121
Raoul Hippchen, etliche schöne begrebnissen vnnd epitaphia. Ein fürstlicher Brief zu den Grabdenkmälern in St. Arnual und eine bislang unbeachtete Sammlung nassauischer Inschriften, S. 123-138
Julia Noll, Ein spektakulärer Quellenneufund. C. Seibert und seine Zeichnungen von heute verlorenen Grabplatten aus der Marburger Elisabethkirche, S. 139-149
Edgar Siedschlag, Incisionis mnemosynon pium. Zur metrischen Analyse eines verderbt überlieferten Grabgedichts, S. 151-157
Uwe Gast, Zu Besuch im Gasthaus Zum goldenen Rindfuß in Nürnberg, S. 159-169
Ramona Baltolu, Eine ungewöhnliche Votivgabe in Sossau, S. 171-176
Wolfgang Müller, Impressionen zur Geschichte des Historischen Instituts der Universität des Saarlandes in den 60er Jahren, S. 177-186
Franz-Albrecht Bornschlegel, Die Erdbebeninschriften von Wombach und Gelnhausen. Eine epigraphische Gratwanderung, S. 187-195.