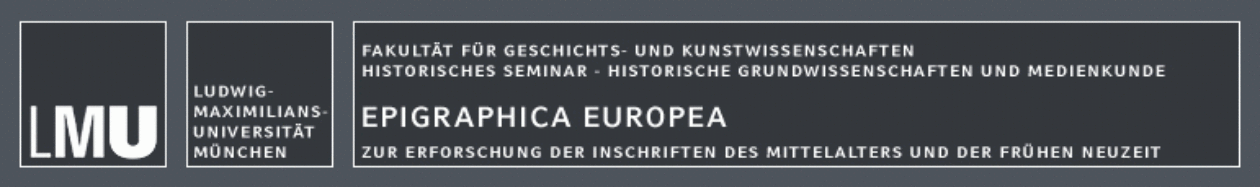20. zasedání k problematice sepulkrálních památek,´
Program
úterý 2. listopadu 2021
9.30 registrace, ranní káva
10.00–11.00
Ivo Hlobil (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.):Gotický náhrobek sv. Ludmily v Bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Více otázek, než odpovědí.
Marcin Szyma / Marek Walczak (Instytut Historii Sztuky, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Nagrobek św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie z lat 1581–1583. Próba rekonstrukcji.
11.20–12.40
Martina Kudlíková (Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity): In ambitu sepulcra est. Sepulkrální témata ve středověkých mendikantských ambitech a pokus ojejich interpretaci.
Tomáš Gaudek (Národní památkový ústav, generální ředitelství)Renesanční epitafia a sepulchralia ve fondech Národního památkového ústavu Zdeněk Procházka (Domažlice) / Jan Oulík (Charita Česká republika): Dvakrát z Tachovska. Náhrobník tachovského mana Nikla Gryse a epitaf Šebestiána Perglára z Perglasu.
14.00–15.10
Jiří Brňovják (Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity): Epitaf Karla Julia Sedlnického z Choltic (†1731) jako součást veřejné prezentace barokní katolické aristokracie Opavského knížectví.
Martina Kvardová (Numismatické oddělení Moravského zemského muzea v Brně): Sepulkrální památky v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.
ZprávaJana Bělová (Muzeum města Prahy): Fragmenty mříže z náhrobku sv. Ivana v Muzeu hlavního města Prahy.
15.30–16.30
Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze): Sekundární náhrobky na židovských hřbitovech.
Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy): Olšanské hřbitovy v Praze na konci.
středa 3. listopadu 2021
9.30 registrace, ranní káva
10.00–11.20
Zdeněk Vácha (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně): Náhrobník probošta Jana z Althannu v lapidáriu hradu Špilberku v Brně.
Miro Čovan (Ústav cudzích jazykov JLF, Univerzita Komenského, Martin): Sepulkralie na Slovensku v zrkadle archívnych prameňov a starých rukopisov.
Martina Hrdinová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.): Knihy účtů augustiniánského kláštera u Sv. Tomáše v Praze jako sekundární pramen k sepulkrálním památkám.
11.40–13.00
Bogusław Czechowicz (Ústav historických věd, Fakulta filozoficko-přírodovědecká Slezské univerzity v Opavě): Méně známý rukopis Joannesa Jacoba Brunettiho z roku 1692 s nápisy na vratislavských sepulkrálních památkách ve sbírce Národní knihovny ve Varšavě. Příspěvek k dějinám epigrafických inventarizací v zemích Koruny české.
Olga Miriam Przybyłowicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa): Pochówki ksień klarysek w Gnieźnie (XIV–XVIII w.) w świetle rękopisu Księgi wszystkich spraw konwentu gnieźnieńskiego zakonu Ś. Klary […] 1609
Pavel Holub (Katedra archivnictví a pomocných věd historických, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně): Šlechtické hrobky druhé poloviny 19. a první čtvrtiny 20. století v kontextu úředního řízení.
14.30–16.00
Vojtěch Kessler (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) / Josef Šrámek (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) / Marie Michlová (Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy): Hrob známého vojína. De-anonymizace válečných pomníků a hromadných hrobů jako modnizační proces?
Zuzana Křenková (Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha) / Vladislava Říhová (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice): Výzdoba hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě z berlínské mozaikové produkce
Pavla Vrbová (Praha): Historie kaplových hrobek na Malostranském hřbitově.
Petr Béna (Správa pražských hřbitovů, Praha): Záchrana pískovcových náhrobků v havarijním stavu na Malostranském hřbitově v Praze
Postery (diskuse s autory bude možná během přestávek jednání)
Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze) / Iva Steinová (Matana a. s.) / Petra Vladařová (Praha): Židovské hřbitovy na jihu Čech.
Martin Klapetek (Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta Jihočeské univerzity): Nápisy psané latinkou na muslimských hrobech v Německu a Rakousku.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční poplatek se nevybírá, pořadí příspěvků a časový harmonogram se mohou změnit. Vstup na konferenci bude vázán na aktuální epidemiologická opatření ministerstva zdravotnictví.
Kontakt: rohacek@udu.cas.cz
www.udu.cas.cz
Mediálním partnerem akce je internetový portál PROPAMÁTKY.
20. Sitzung zum Thema Grabdenkmäler
Dienstag, 2. November 2021
Programm:
9.30 Anmeldung, Morgenkaffee
10.00–11.00
Ivo Hlobil (Institut für Kunstgeschichte der ASCR, v. V. I.): Der gotische Grabstein von St. Ludmila in der Basilika St. Georg auf der Prager Burg. Mehr Fragen als Antworten.
Marcin Szyma / Marek Walczak (Institut für Kunstgeschichte, Jagiellonen-Universität Krakau): Das Grab des hl. Jakobus in der Dominikanerkirche in Krakau von 1581-1583.
11.20–12.40
Martina Kudlíková (Kunsthistorisches Seminar, Philosophische Fakultät, Masaryk-Universität): Im Kreuzgang befindet sich das Grab. Grabthemen in mittelalterlichen Bettelorden und ein Versuch, sie zu interpretieren.
Tomáš Gaudek (Nationales Denkmalinstitut, Generaldirektion): Renaissance Epitaph und Sepulchralia im Fonds des Nationalen Denkmalinstituts.
Zdeněk Procházka (Domažlice) / Jan Oulík (Caritas Tschechien): Zweimal aus Tachov. Der Grabstein von Nik Grys und das Epitaph von Sebastian Perglár
14.00–15.10
Jiří Brňovják (Fakultät für Geschichte, Fakultät für Kunst, Universität Ostrava): Das Epitaph von Karel Julius Sedlnický von Choltice († 1731) im Rahmen einer öffentlichen Präsentation von die barocke katholische Aristokratie des Fürstentums Opava Provinzmuseum in Brünn) Grabdenkmäler im Bereich der Kirche Mariä Himmelfahrt in Vranov nad Dyjí.
Jana Bělová (Museum der Stadt Prag): Ivan im Museum der Hauptstadt Prag.
15.30–16.30
Daniel Polakovič (Jüdisches Museum in Prag): Sekundärgrabsteine auf jüdischen Friedhöfen.
Blanka Soukupová (Fakultät für Geisteswissenschaften, Karlsuniversität): Der Olšany-Friedhof in Prag am Ende des 19. und 20. Jahrhunderts. Berufliches und bürgerliches Interesse.
Mittwoch, 3. November 2021
9.30 Anmeldung, Morgenkaffee
10.00–11.20
Zdeněk Vácha (Nationales Denkmalinstitut, regionale Facheinrichtung in Brünn): Grabstein des Propstes Jan von Althann im Lapidarium der Burg Špilberk in Brünn.
Miro Čovan (Fachbereich Fremdsprachen JLF, Comenius-Universität, Martin): Sepulkralkultur in der Slowakei im Spiegel archivalischer Quellen und alter Handschriften.
Martina Hrdinová (Masaryk-Institut und Archiv der ASCR, v. V. I.): Rechnungsbücher des Augustinerklosters Sv. Tomas in Prag als Sekundärquelle für Grabdenkmäler.
11.40–13.00
Bogusław Czechowicz (Fakultät für Geschichtswissenschaften, Fakultät für Philosophie und Naturwissenschaften, Schlesische Universität in Troppau): Eine weniger bekannte Handschrift von Joannes Jacob Brunetti aus dem Jahr 1692 mit Inschriften auf Breslauer Grabdenkmälern in der Sammlung der Nationalbibliothek in Warschau. Ein Beitrag zur Geschichte der epigraphischen Inventare in den Ländern der böhmischen Krone.
Olga Miriam Przybyłowicz (Institut für Archäologie und Ethnologie PAN, Warschau): Gilden des Zigeunerkorps in Gnesen (XIV-XVIII) Klary […] 1609.
Pavel Holub (Institut für Archivwissenschaft und historische Hilfswissenschaften, Philosophische Fakultät, Jan Evangelista Purkyně-Universität): Adelsgräber der zweiten Hälfte des 19. und des ersten Viertels des 20. Jahrhunderts im Rahmen von Amtshandlungen.
14.30–16.00
Vojtěch Kessler (Institut für Geschichte der ASCR, v. V. I.) / Josef Šrámek (Ostböhmisches Museum in Hradec Králové) / Marie Michlová (Institut für Weltgeschichte, Philosophische Fakultät, Karlsuniversität): Grab eines berühmten Soldaten. Entanonymisierung von Kriegerdenkmälern und Massengräbern als Modernisierungsprozess?
Zuzana Křenková (Institut für Chemische Technologie der Denkmalrestaurierung, ICT Prag) / Vladislava Říhová (Fakultät für Restaurierung, Universität Pardubice): Dekoration des Grabes der Familie Dittrich in Krásná Lípa aus einer Berliner Mosaikproduktion.Pavla Vrbová (Prag): Geschichte der Kapellengräber auf der Kleinseite des Friedhofs.
Petr Béna (Prager Friedhofsverwaltung, Prag): Rettung von Sandstein-Grabsteinen in baufälligem Zustand auf dem Prager Kleinseitner Friedhof.
Poster (Diskussion mit den Autoren ist in den Sitzungspausen möglich)
Daniel Polakovič (Jüdisches Museum in Prag) / Iva Steinová (Matana a. S.) / Petra Vladařová (Prag): Jüdische Friedhöfe in Südböhmen.Martin Klapetek (Institut für Philosophie und Religionswissenschaft, Theologische Fakultät, Südböhmische Universität): Lateinische Inschriften auf muslimischen Gräbern in Deutschland und Österreich.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben, die Reihenfolge der Beiträge und der Zeitplan können sich ändern.Der Eintritt zur Konferenz wird an aktuelle epidemiologische Maßnahmen des Gesundheitsministeriums geknüpft.
Kontakt: rohacek@udu.cas.czwww.udu.cas.cz
Medienpartner der Veranstaltung ist das Internetportal PROPAMÁTKY.