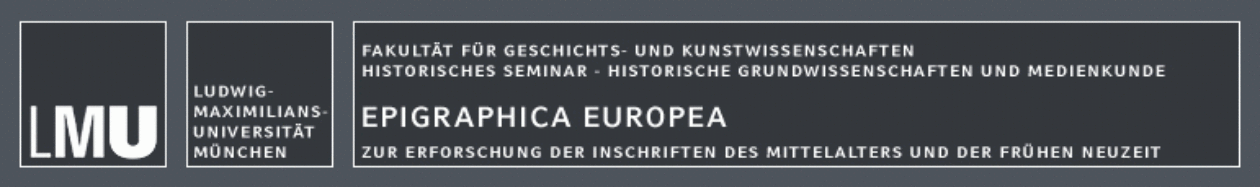Archiv der Kategorie: Aktuelles
Inschriften auf Papier – Call for papers
Call for papers
Inschriften auf Papier. Gedruckte und handschriftliche Inschriften-
sammlungen in Europa vom 15. bis 20. Jahrhundert (Arbeitstitel)
INSCHRIFTEN SIND ÜBERLIEFERUNGSWÜRDIG. Diese banale Wahrheit ist keineswegs eine Erfindung der modernen Wissenschaft. Die epigraphischen Großprojekte, wie „Corpus Inscriptionum Latinarum“ oder „Die Deutschen Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ haben das Sammeln und Bearbeiten solcher Texte systematisiert und wissenschaftlich geformt, der Ursprung dessen kann aber mehrere hundert Jahre früher beobachtet werden. Bereits im Spätmittelalter setzte eine Entwicklung ein, die inschriftlichen Texten eine Bedeutung beimaß, diese sammelte und in teils umfangreichen Drucken der Nachwelt zur Verfügung stellte. Eine gewichtige Rolle spielten hierbei die humanistischen Gelehrten des 16. Jahrhunderts. 1) Besonders die Arbeit an den Bänden der „Deutschen Inschriften“ zeigt allerdings auch, dass Sammlungen nicht nur im Umfeld humanistischer Gelehrter entstanden, sondern sich im Laufe der Frühen Neuzeit immer weitere Personenkreise, wie Geistliche, Bürger oder Ratsangehörige aufmerksam durch „ihre“ Städte, Kirchen und ländlichen Räume bewegten und inschriftliche Texte von Grabmälern, Hausfassaden oder Eingangsportalen abschrieben. Die Überlieferung ist außerordentlich vielfältig und in der Forschung noch nicht in umfassendem Maße abgebildet. Der geplante Sammelband soll gedruckte und handschriftliche Inschriftensammlungen ab dem 15./16. Jahrhundert daher in ihrer Gesamtheit in den Blick nehmen. Ziel des Projekts ist es, einen
Überblick zur Entstehung, zum Kontext und zur Bedeutung der Inschriftensammlungen sowie zu den Sammlern zu erarbeiten. Der Band soll den Beginn tiefgreifender Forschungen mit dem Thema bilden. Geplant ist eine Veröffentlichung als Themenheft im „Archiv für Epigraphik“ für den Jahrgang 2026 als Online-Format. Mit diesem Aufruf wird für ein Einreichen entsprechender Beiträge geworben. Das Projekt versteht sich dabei ausdrücklich als epochenübergreifend, es soll nicht zwischen antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Inschriften unterschieden oder getrennt werden. Als Leitfragen werden vorgeschlagen: Wann entstehen solche Sammlungen und in welchen Kontexten? Gibt es regionale zeitliche Unterschiede? Wer sind die Sammler? Welchen biographischen Hintergrund haben sie? Welche Arten von Texten werden aufgeschrieben (inhaltlich, sprachlich)? In welchem Umfang wurde gesammelt? Galt das Interesse vorrangig repräsentativen Objekten oder verzeichnete man die Überlieferung ganzheitlich? Verfasste man reine Sammlungen oder integrierte man Nachweise in anderen Gattungen, wie bspw. Chroniken? Wie wurden die Texte übertragen, in einer einfachen inhaltlichen Wiedergabe oder versuchte man Inschrift und Träger in ihrer Gestaltung abzubilden (Nachahmung der Schriftart; Umzeichnung des Trägers)? Wie glaubwürdig bzw. zuverlässig sind die Kopisten? Nahm man die Objekte selbst in Augenschein oder schrieb man andere Kopisten ab? Handelt es sich um für die Öffentlichkeit bestimmte Drucke oder um archivalisch überlieferte Handschriften aus Nachlässen? Welche Bedeutung haben Kopisten für die heutige Kenntnis inschriftlicher Überlieferung in einer Region oder an einem Ort bzw. in welcher Weise haben sie die Überlieferung geprägt und beeinflusst?
1) Andreas Zajic, Inventionen und Intentionen eines gelehrten Genres. Gedruckte Inschriftensammlungen des 16. und frühen
17. Jahrhunderts; mit exemplarischen Glossen zur Praxis (epigraphischer) Gelegenheitsdichtung des Adels in der frühen Neuzeit, in: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext (Vorträge der 11. Internationalen Fachtagung für Epigraphik, Greifswald 9.–12.5.2007), hrsg. von / ed. by Christine Magin, Ulrich Schindel, Christine Wulf, Wiesbaden 2008, S. 165–192.
Um Themenvorschläge wird bis zum 31. August 2025 gebeten; um die verschriftlichten Beiträge bis zum 30. April 2026. Beiträge können inhaltlich aus dem gesamten europäischen Forschungs-
raum eingereicht werden; als Wissenschaftssprachen wird um Deutsch oder Englisch gebeten.
Dr. des. Thomas Rastig
Archiv für Epigraphik / Redakteur und Mitherausgeber / co-editor
Sächsische Akademie der Wissenschaften / Wissenschaftlicher Mitarbeiter / research associate
rastig@saw-leipzig.de
www.epigraphik.org
Call for papers
Inscriptions on Paper. Printed and Manuscript Collections of Inscriptions in Europe from the 15th to the 20th Century (working title) INSCRIPTIONS ARE WORTHY OF PRESERVATION. This seemingly self-evident truth is by no means a product of modern scholarship. Major epigraphic projects such as the „Corpus Inscriptionum Latinarum“ and „Die Deutschen Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ have systematised and shaped the collection and academic treatment of such texts. However, the origins of this practice can be traced back several centuries earlier. Already in the late Middle Ages, people began to attribute significance to inscribed texts, collect them, and make them available to posterity through often extensive printed editions.
Humanist scholars of the 16th century played a key role in this process.1) Work on the volumes of „Die Deutschen Inschriften“ has shown, that such collections did not originate solely within the
circles of humanist scholars. Over the course of the Early Modern period, an increasingly broad range of individuals – including clergy, townspeople, and members of municipal councils – began to move attentively through their cities, churches, and rural areas, copying inscribed texts from tombstones, house façades, and entrance portals. The transmission of these texts is extraordinarily diverse and has yet to be comprehensively represented. The planned edited volume aims to provide a comprehensive examination of printed and manuscript collections of inscriptions from the 15th/16th century onwards. The objective of the project is to offer an overview of the origins, contexts, and significance of these collections, as well as of the individuals who compiled them. The volume is intended to serve as a starting point for in-depth research into this subject. Publication is planned as a thematic issue of „Archiv für Epigraphik“ (2026 volume), to be published in an online format. This call invites the submission of suitable contributions. The project explicitly adopts a transpochal approach: no distinction or separation is to be made between ancient, medieval, and early modern inscriptions. The following guiding questions are proposed: When did such collections emerge, and in what contexts? Are there regional or chronological variations? Who were the collectors, and what were their biographical backgrounds? What types of texts were recorded (in terms of content and language)? What was the scope of the collections? Was the focus primarily on prestigious objects, or was the transmission documented in a more comprehensive manner? Were independent collections compiled, or were inscriptions integrated into other genres, such as chronicles? How were the texts transcribed – as simple reproductions of content, or with attempts to capture the form and design of the inscriptions and their material supports (e.g. imitation of script styles; drawings or tracings of the inscribed objects)? How credible or reliable were the copyists? Did they examine the objects directly, or were their copies based on other sources? Were the resulting collections intended for publication, or are they archival manuscripts preserved in private or institutional holdings? What is the significance of these copyists for our current understanding of epigraphic transmission in a given region or locality, and in what ways did they shape or influence that transmission?
Proposals for contributions are requested by 31 August 2025, with final submissions of written articles due by 30 April 2026. Contributions may address material from across the European area.
Articles may be submitted in either German or English.
1) Andreas Zajic, Inventionen und Intentionen eines gelehrten Genres. Gedruckte Inschriftensammlungen des 16. und frühen
17. Jahrhunderts; mit exemplarischen Glossen zur Praxis (epigraphischer) Gelegenheitsdichtung des Adels in der frühen Neuzeit, in: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext (Vorträge der 11. Internationalen Fachtagung für Epigraphik, Greifswald 9.–12.5.2007), hrsg. von / ed. by Christine Magin, Ulrich Schindel, Christine Wulf, Wiesbaden 2008, S. 165–192.
Dr. des. Thomas Rastig
Archiv für Epigraphik / Redakteur und Mitherausgeber / co-editor
Sächsische Akademie der Wissenschaften / Wissenschaftlicher Mitarbeiter / research associate
rastig@saw-leipzig.de
www.epigraphik.org
Round table OUTILS,GESTES ET TECHNIQUESDE L’INSCRIPTIONAUMOYENÂGE, Poitiers, 09.01.2025
Table ronde: Outils, gestes et techniques de l’inscription au Moyen Âge | LA MAISON DE L’EPIGRAPHIE
Jeudi 9 janvier 2025 – 14h-18h
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (Université de Poitiers-CNRS) 24, rue de la Chaîne – Salle Crozet
Diese Diskussionsrunde stützt sich auf die Dissertation von Thierry Grégor, die im Januar 2023 am CESCM verteidigt wurde und den Titel „Étude technique des inscriptions médiévales en Poitou-Charentes“ trägt. Sie schlägt einen entschieden technischen Ansatz der Steinschrift vor, der in das Material eingebettet ist und mit der autoptischen Analyse der Stücke, der Erstellung von Chronotypologien, der Hervorhebung der großen Phänomene der Entwicklung, der Anpassung und der Anpassung sowie der Bedeutung von Gesten und Körperhaltungen in Verbindung steht.
Ausgehend von den intellektuellen Wegen, die sich aus dieser Studie ergeben, schlägt das Rundtischgespräch vor, gemeinsam einen Blick auf die umfassenderen Fragestellungen zu werfen, die das Studium der mittelalterlichen Schriftkultur natürlich antreiben, aber auch die Anthropologie der Schrift, die globale Geschichte der epigraphischen Praktiken, die Geschichte der Techniken, die Anthropologie der Arbeit und die allgemeinen Überlegungen zum Alphabetischen. (Übersetzt mit DeepL.com)
Avec la participation de :
- Hélène CAMPAIGNOLLE (CNRS-THALIM, Paris)
- Vincent DEBIAIS (CNRS-CRH, Paris),
- Pierre-Olivier DITTMAR (EHESS, Paris),
- Béatrice FRAENKEL (EHESS, Paris),
- Thierry GRÉGOR (CESCM, Poitiers),
- Sonja HERMANN (Commission épigraphique de Bonn),
- Estelle INGRAND-VARENNE (CNRS-CESCM, Poitiers),
- Chloé RAGAZZOLI (EHESS, Paris),
- Benoît TOCK (Université de Strasbourg)
Contact pour information : estelle.ingrand.varenne@univ-poitiers.fr
Les ateliers, Workshop Poitiers, 10.01.2025
Les ateliers « Les acteurs de l’inscription : la question des ateliers »
Workshop GRAPH-EAST : les ateliers | LA MAISON DE L’EPIGRAPHIE
POTIERS, CESCM, SALLE CROZET, 10 JANVIER 2025
9h45 Accueil
10h Introduction, Estelle Ingrand-Varenne, « Peut-on
parler d’ateliers pour les inscriptions médiévales ? »
10h15-12h Thierry Grégor, « Comment grave-t-on une
dalle funéraire à Chypre au Moyen Âge, de A à Z ? »
13h30-14h30 Claire Boisseau, « L’atelier du peintre
entre concepts et pratiques »
14h30-15h30 Amal Azzi, « L’atelier des tombiers :
enquête sur l’identité à partir des plates-tombes à
effigie. Méthodes et perspectives. »
16h-17h Héloïse Dupin, « Œuvres de maçon, de
tailleur de pierre et/ou d’imagier, les dais du palais de
Poitiers commandé par Jean de Berry »
Inscriptions : des textes aux musées, Paris, 16.11.2024
Inscriptions : des textes aux musées, journée d’études 16 novembre 2024 (Inschriften: von den Texten zu den Museen, Studientag 16. November 2024)
Am Samstag, den 16. November findet in Paris, (Sorbonne amphithéâtre Quinet – 46, rue Saint-Jacques) ein Studientag statt, der den Inschriften gewidmet ist, die in französischen und internationalen Museen aufbewahrt werden. Obwohl sie dank der Online-Bereitstellung bestimmter Inschriften eine größere Sichtbarkeit als in der Vergangenheit genießen Museumssammlungen, sind diese Korpora immer noch weitgehend unbekannt und werden zu wenig genutzt. Als privilegierte Zeugen der Zirkulation von Texten, die sich vom handschriftlichen Träger lösen und in den Gegenstand übergehen, und von Artefakten – von denen manche, durch die Unwägbarkeiten ihrer Aufbewahrung getrennt, beide Teile ein und derselben Inschrift tragen und sich aus der Ferne, von einem Museum zum anderen, zuwinken – bieten mittelalterliche Inschriften ein Studienobjekt, das die Felder der Kunstgeschichte, der Literatur- und Sprachwissenschaft, der Epigraphik und der material studies kreuzt. Die Problematik dieses Kolloquiums ist die Frage nach der Zirkulation von Texten und ihrer Übertragung auf „beschriftete“ Objekte, die ihrerseits mobil sein können, seien es religiöse und sakrale Objekte – Kreuze, Schreine, Kelche, Reliquienschreine, Bischofsstäbe, tragbare Altäre, Pilgerschilder etc, oder während einer rituellen Zeremonie oder einer Pilgerfahrt verwendet wurden, oder weltliche Gegenstände – Fliesen, Kästchen, Glöckchen, Spiegel, Ringe, Medaillen, Waffen, Glas und Buntglas, Stoffe und Wandteppiche, Schilder usw. -, die in einer rituellen Zeremonie oder einer Pilgerfahrt ausgestellt oder verwendet wurden, oder Gegenstände, die in einer rituellen Zeremonie oder einer Pilgerfahrt ausgestellt oder verwendet wurden. (Übersetzt mit DeepL.com)
Comité d’organisation : Sandrine Hériché Pradeau (MCF HDR Linguistique médiévale), Sylvie Lefèvre (PR Littérature médiévale), Gabriella Parussa (PR Linguistique médiévale).
Inscription par courriel : sandrine.heriche-pradeau@sorbonne-universite.fr
Programme
9h30 – Accueil des participants
9h45 – Introduction
10h00 – Vincent Debiais (CNRS-EHESS), « L’écriture médiévale au musée : questions de méthode »
10h30 – Laurent Hablot (EPHE), « Inscriptions emblématiques du Moyen Âge et collections muséales »
Discussion
11h10 – Pause
11h20 – Sonia Fellous (IRHT-CNRS), « Inscriptions hébraïques et juives de la France antique et médiévale »
11h50 – Maud Pérez-Simon (Sorbonne Nouvelle), « Des inscriptions dans les musées : l’exemple des plafonds peints »
12h15 – Discussion
12h30 – Déjeuner
14h30 – Thierry Gregor (Chercheur associé au CESCM -Graph-East), « De l’Orient aux musées de Cluny et du Louvre : la circulation
des textes inscrits et des techniques »
15h00 – Maria Aimé Villano (Postdoc ERC -Graph-East), « L’expédition d’Eugène Magen et les inscriptions funéraires médiévales de l’île de Chypre »
15h30 – Discussion
15h45 – Pause
16h00 – Sylvie Lefèvre (Sorbonne Université), « ‘La verge entur estoit lettree’ (Marie de France, Lai de Freisne, v. 131). Inscriptions sur des objets de luxe et reconnaissance des fragments littéraires. »
16h30 – Sandrine Hériché Pradeau (Sorbonne Université), « Prolégomènes à une étude des inscriptions dans les tapisseries de
chœur de la fin du Moyen Âge »
Conclusions
16. Internationale Fachtagung für mittelalterliche und frühneuzeitliche Epigraphik, Leipzig 7.-9.10.2024
„Texttransfer und intertextuelle Bezüge in den Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“. 16. Internationale Fachtagung für mittelalterliche und frühneuzeitliche Epigraphik, Leipzig, 7.-9.10.2024, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Karl-Tauchnitz-Straße 1, 04107 Leipzig.
Kontakt und Anmeldung
Dr. des. Thomas Rastig
Tel.: +49 (0)345 5522927
rastig@saw-leipzig.de
Um Anmeldung wird gebeten bis 16.09.2024.
Programm:
MONTAG, 07. Oktober 2024
13.00 Uhr: Wolfgang Huschner, Vizepräsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig: Begrüßung
Moderation: Klaus Krüger (Halle/Saale, D)
13.15 Uhr: Franz Jäger (Halle/Saale, D): Von den Tugenden eines fromen Hausherrn. Zitate an und in Bürgerhäusern der Frühen Neuzeit. Ein Problemaufriss
13.45 Uhr: Michael Oberweis (Mainz, D): Quod natura negat, nemo reddere potest. Abwandlungen und Entstellungen im inschriftlichen Zitatgebrauch der Frühen Neuzeit
14.45 Uhr: Kaffeepause
15.15 Uhr: Jens Borchert-Pickenhan (Halle/Saale, D): Tu Marcellus eras. Über „echte“ und „unechte“ Schriftstellerzitate in Inschriften
15.45 Uhr: Nicoletta Giovè (Padua, IT): Strategien der Hervorhebung. Beispiele und Bemerkungen
DIENSTAG, 08. Oktober 2024
Moderation: Katharina Kagerer (Göttingen, D)
9.00 Uhr: Juraj Šedivý (Bratislava, SK): Inschriften und ihre Prätexte im mittelalterlichen Karpatenbecken
9.30 Uhr: Šime Demo (Zagreb, HR): Intertextuality in the Latin inscriptions of early modern Croatia
10.30 Uhr: Kaffeepause
11.00 Uhr: Jochen Hermann Vennebusch (Hamburg, D)
Ecce panis angelorum. Inschriften auf westfälischen vasa sacra des späten Mittelalters und ihre Prätexte
11.30 Uhr: Falko Bornschein (Erfurt, D): Dies tut zu meinem Gedächtnis! Zum Verweischarakter der Inschriften auf den mittelalterlichen Glasmalereien des Erfurter Domchores
12.30 Uhr: Mittagspause
Moderation: Bruno Klein (Dresden, D)
14.00 Uhr: Ulrike Spengler-Reffgen (Bonn, D): Veni domine visitare nos in pace. Liturgische Texte in Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
14.30 Uhr: Maia Wellington Gahtan (Firenze, IT): Patris Opus. Constantinus II, Sixtus V and the Shadow of Constantine the Great on the Obelisk at St. John Lateran
15.30 Uhr: Kaffeepause
16.00 Uhr: Sophia Victoria Clegg (Bonn, D): Pars pro toto. Zitate und Paraphrasen an Stadttoren im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit
16.30 Uhr: Ilas Bartusch (Heidelberg, D): O Mensch bedencke Dich – Schwör ja nicht Frevendtlich! Die Textvorlagen für die Beschriftung der frühneuzeitlichen Eidtafel zu Filderstadt-Sielmingen
19.00 Uhr: Abendvortrag: Hans Ulrich Schmid (Leipzig, D): Die Bibel als „Prätext“. Lutherzitate in Inschriften
Empfang im Anschluss
MITTWOCH, 09. Oktober 2024
Moderation: Sebastian Roebert (Leipzig, D)
9.00 Uhr: Christian Schuffels (Dresden, D): Texttransfer in Hildesheimer Grabinschriften des hohen Mittelalters
9.30 Uhr: Julia Anna Schön (Wien, AT): Epigraphische Reflexe der medialen Inszenierung im Rahmen der Kanonisationsbestrebungen Markgraf Leopolds III. von Österreich
10.30 Uhr: Kaffeepause
11.00 Uhr: Rodney Lokaj (Enna, IT): An epitaph truly fit for an artist: Lorenzo de’ Medici and Politian on Filippo Lippi
11.30 Uhr: Julia Noll (Mainz, D): Gelehrsamkeit und Seelenheil. Zitate und literarische Anspielungen in frühneuzeitlichen Grabinschriften der Marburger Elisabethkirche
12.30 Uhr: Kaffeepause
13.00 Uhr: Thomas Gärtner (Köln, D): Epigraphische Lokaldichtungen innerhalb des griechisch-lateinischen Gesamtwerks des Lorenz Rhodoman (1545–1606)
13.30 Uhr: Arsenii Vetushko-Kalevich (Lund, SE): Masters of the genre. Repetition and variation in Latin funerary inscriptions from Sweden penned by the same authors Axel Oxenstierna, Laurentius Fornelius, Haquin Spegel and Andreas Rhyzelius
14.30 Uhr: Tagungsende und Verabschiedung
Hinweis zum Programmablauf: Nach zwei Vorträgen ist jeweils eine halbstündige Diskussion geplant.
Writing on the Margins. Graffity in Italy and beyond, international Conference, Rome, 10-12 April 2024
Writing on the Margins. Graffity in Italy and beyond (7th – 16th c.), First International Conference of the ERC-2020-AdG Graff-IT project, Royal Netherlands Institute in Rome (KNIR), Rome, 10-12 April 2024.
The first international conference of the ERC-2020-AdG Graff-IT Project aims at bringing together scholars from all over Europe who are concerned with the study of medieval and Renaissance graffiti as a historical source. “Graffiti” and “margins” are the two key, interrelated concepts which this conference wants to further explore from a European and multidisciplinary perspective, with papers embracing a broad chronological timeline that begins in the early Middle Ages and extends to include the early modern period (7th-16th c.). Taken together, these two key-concepts explain the importance of graffiti as a historical source capable of providing first-hand evidence of a wide variety of aspects of past societies, and therefore, worthy of being studied in its own right, alongside the conventional ones. The conference, thus, seeks to provide an interdisciplinary forum for scholars who are willing to discuss several topics related to graffiti from continental and insular Europe, thereby contributing to an in-depth and better assessment of the material evidence uncovered from surveys within the Italian peninsula. Programme 9 April 15:30/17.30 – Reception participants and introductory remarks (Rome, KNIR) 20:00 – Dinner 10 April 9:15/10:00 – Welcome and opening remarks 10:00/10:30 – Carlo Tedeschi (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara), Keynote lecture 10:30/11:00 – Véronique Plesch (Colby College, USA), Graffiti on frescoes: typology, models, metaphors, and critical frameworks 11:00/11:15 – Coffee break 11:15/11:45 – Estelle Ingrand-Varenne (CNRS Poitiers) – Clément Dussart (University of Poitiers), On the margins of graffiti: writings ‘fixed’ to pilgrimage sites in the Holy Land 11:45/12:15 – Khachik A. Harutyunyan (Scientific Research Center of the Historical and Cultural Heritage, Matenadaran), The Armenian graffiti of the church of Holy Sepulcher 12:15/12:45 – Adam Łajtar (University of Warsaw), Wall graffiti in Christian Nubia. Discussant: Oliva Menozzi (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara) 13:00/14:30 – Lunch break 14:45/15:15 – Wendy Scase (University of Birmingham), From pillar to page: medieval graffiti in British churches and manuscript marginalia 15:15/15:45 – Laura Pani (University of Udine), Memorial graffiti and Libri vitae: an intersection? 15:45/16:15 – Elisa Pallottini (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara), Nominal graffiti and liturgical objects. Some case studies from the medieval Latin West. Discussant: Nicoletta Giovè (University of Padua) 16:15/16:45 – Final discussion 11 April 9:45/10:00 – Poster 3: Roberto Rotondo (Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo – Taranto), Cristina Comasia Ancona (Independent researcher), «Caverna(e) solertes inquisitores». A scratched testimony of a speleological exploration in the 16th c. in Martina Franca (Taranto) 10:00/10:30 – Discussion on posters 1-3. Discussants: Pier Paolo Trevisi (University for Foreigners of Perugia) and Martina Cameli, Antonello Vilella (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara) 10:30/10:45 – Coffee break 10:45/11:00 – Poster 4: Desi Marangon (Independent researcher), The graffiti of the Arsenale in Venice: a preliminary survey (17th c.) 11:00/11:15 – Poster 5: Flavia Tudini (Fondazione Bruno Kessler – Trento), Prisons’ graffiti. Justice, society and images in the Trentino prison system in the modern age (16th-19th c.) 11:15/11:30 – Poster 6: Rocco D’Errico (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara), Diagnostic imaging applied to the study of graffiti: photogrammetry, RTI, high-resolution photos, multispectral photography, virtual tours 11:30/12:00 – Discussion on posters 4-6. Discussants: Simone Allegria – Sabrina Centonze (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara), Antonella Undiemi (University of Padua) 12:30/14:00 – Lunch break 14:15/18:00 – Excursion with the guide of Marco Albertoni, Vittoria Sichetti, Carlo Tedeschi (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara) 12 April 9:00/9:15 – Opening of the works 9:15/9:45 – Kristel Zilmer (University of Oslo), Runic graffiti and inscriptional spaces in medieval Norway 9:45/10:15 – Jos Schaeken (Leiden University), The place of graffiti in the graphic environment of Kyivan Rus 10:15 /10:30 – Coffee break 10:30/11:00 – Béatrice Fraenkel (EHESS, Paris), How did Petrucci manage (or not) to integrate graffiti into La Scrittura...? Discussant: Antonella Ghignoli (Sapienza University of Rome) 11:00/11:45 – Final discussion with the participation of Francesca Malagnini (University for Foreigners of Perugia), Gaetano Curzi, Mario Marrocchi (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara) 11:45/12:30 – Marco Mostert (Utrecht University), Closing lecture 12:30/13:30 – Lunch break 13:30/14:30 – Closing remarks and end of the works Scientific Committee: Carlo Tedeschi (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara), Nicoletta Giovè (University of Padua), Francesca Malagnini (University for Foreigners of Perugia), Marco Mostert (Utrecht University) Promoting Committee: Carlo Tedeschi (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara), Simone Allegria (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara), Elisa Pallottini (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara), Maria Bonaria Urban (Royal Netherlands Institute [KNIR]) Technical Secretary: Studio Eventi & Congressi (segreteria@eventiecongressi.it)
Spezialfragen der Inschriftenpaläographie, Klosterneuburg 25.-26.3.2024
Spezialfragen der Inschriftenpaläographie, Klosterneuburg 25.-26.3.2024
Expert·innengespräch Stift Klosterneuburg | Quartier 1114
Vormoderne Inschriften wurden in den unterschiedlichsten Materialien (Stein, Metall, Glas, Textilien usw.) und Techniken ausgeführt. An die Vielfalt der Ausführungsmodi knüpfen sich unterschiedliche Bewertungen (und Datierungsansätze) der jeweiligen Schriftformen. Epigraphiker·innen arbeiten in Datierungsfragen für gewöhnlich mit der geradezu dogmatisch gewordenen Hypothese, dass etwa (als Wandmalereien bzw. auf Glas) gemalte Inschriften progressivere Formen (früher) aufweisen als etwa in Stein gehauene Schriftdenkmäler. Dass Fragen der Ausführungstechnik und der Materialgerechtigkeit eine wesentliche Rolle spielen, ist zwar evident, im Detail aber bislang kaum eingehender und vergleichend untersucht worden.
Das Expert·innengespräch soll nun im Vergleich von zeitnahen bzw. gleichzeitigen Inschriften in Stein, Metall, Glas und Textil die Möglichkeit ausloten, Phänomene synchroner und diachroner Schriftentwicklung vor dem Hintergrund der differierenden Materialien und Techniken zu verstehen.
Die bewusst eng fokussierte Veranstaltung soll Fachwissenschafter·innen und Praktiker·innen (Künstler·innen/Restaurator·innen) als Expert·innen auf Augenhöhe in Austausch bringen. Nach einer Einführung durch die Organisator·innen werden vier Themenblöcke den Formen und Entstehungsbedingungen bzw. Ausführungstechniken von Inschriften in unterschiedlichen Materialien nachspüren. Einer exemplarischen Vorstellung konkreter Objektbeispiele durch die anwesenden epigraphischen Expert·innen als Impulsreferat folgt jeweils ein Kommentar aus Sicht der facheinschlägigen „Praktiker·innen“.
Programm:
Montag, 25. 3.:
9:00-9:30h – Einführung in das Thema: Andreas Zajic, Mathias Mehofer, Materialität und Ausführungstechnik von Inschriften als Forschungsgegenstand von Epigraphik und Archäologie
9:30-10:00h – Inschriften auf Metallobjekten I: Impulsreferat: Clemens M. M. Bayer, Inschriftenpaläographische Aspekte
10:00-10:45h – Inschriften auf Metallobjekten II: Kommentare: Franz Kirchweger, Martina Pippal, Konstantin Nedbal Materialtechnische und kunsthandwerkliche Aspekte – gravierte und emaillierte Inschriften
10:45-11.15h – Inschriften auf Metallobjekten III: Kommentare: Bastian Asmus, Marianne Mödlinger: Materialtechnische und kunsthandwerkliche Aspekte – gegossene Inschriften
11:15-12:00h | Diskussion
13:00-13:15h – Inschriften auf Textilien I: Impulsreferat: Tanja Kohwagner-Nikolai, Inschriftenpaläographische Aspekte
13:15-13:45h – Inschriften auf Textilien II: Kommentare: Michael Peter, Katja Schmitz-von Ledebur, Materialtechnische und kunsthandwerkliche Aspekte
13:45-14:15h – Gemalte Inschriften I: Impulsreferat: Nicoletta Giovè, Andreas Zajic, Zwischen Feder und Pinsel, von Handschrift zu Inschrift: Zum Zusammenhang zwischen Schreiben auf Pergament/Papier und gemalten Inschriften
14:15-15:00h – Gemalte Inschriften II: Kommentar: Christina Wais-Wolf, Angela Vorhofer, Martin Bucher, Inschriften auf Glas
15:00-15:30h – Gemalte Inschriften III: Kommentar: Magdalena Schindler, Inschriften in Wandmalereien
15:30-16:15h | Diskussion
Dienstag 26. 3.:
9:00-10:00h – Inschriften in Stein I: Impulsreferat: Andreas Zajic, Plenum der Teilnehmer·innen, Inschriftenpaläographische Aspekte
10:00-11:00h | Schlussdiskussion
Eine Veranstaltung des Instituts für Mittelalterforschung der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Anmeldung zur Online-Teilnahme:
Julia Anna Schön
JuliaAnna.Schoen[at]oeaw.ac.at
Sommerakademie „Epigraphik zwischen Kulturgeschichte und Digital Humanities“, München 1.-5. August 2022
Die Inschriften stellen aufgrund ihrer vielfältigen Thematik, der Spontaneität ihrer Aussage und ihres überwiegenden Verbleibs am ursprünglichen Anbringungsort eine historische Quelle ersten Ranges dar. Ebenso vielgestaltig wie ihre inhaltlichen Aussagen erweisen sich auch die Erscheinungsformen der Inschriften. Mit Text und Schrift, Methodik und Arbeitsweisen befasst sich im Rahmen einer Interdisziplinären Sommerakademie an der LMU München die einwöchige Veranstaltung „Epigraphik zwischen Kulturgeschichte und Digital Humanities“ vom 1. bis 5. August 2022 an der LMU München.
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Isabelle MOSSONG: Der epigraphische Nachlass der italischen Kleriker (5. ‒ 7. Jahrhundert): Akteure, Gattungen, Praxis
12:30 ‒ 14:00 Uhr: Mittagspause
14:00 ‒ 15:30 Uhr: Julia-Sophie HEIER, Kerstin MAJEWSKI, Gaby WAXENBERGER: Geritzt, gemeißelt und gestempelt ‒ Runeninschriften vom 2. bis ins 16. Jahrhundert, Teil 1: Einführung in die Runologie (Theorieteil)
16:00 ‒ 17:30 Uhr: Julia-Sophie HEIER, Kerstin MAJEWSKI, Gaby WAXENBERGER: Geritzt, gemeißelt und gestempelt ‒ Runeninschriften vom 2. bis ins 16. Jahrhundert, Teil 2: Runeninschriften transliterieren und interpretieren (Praxisteil)
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Rudolf HAENSCH, Eva HAVERKAMP-ROTT, Franz-Albrecht BORNSCHLEGEL, Ramona BALTOLU: Epigraphische Datenbanken (EDH, ECDS, EDR, Ubi-erat-lupa; epidat; Deutsche Inschriften Online, epigraphica europea)
12:30 ‒ 14:00 Uhr: Mittagspause
16:00 ‒ 17:30 Uhr: Christine STEININGER: Katholisch, evangelisch, divers? Inschriftendenkmäler als Quellen für das Bekenntnis in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Ramona BALTOLU: Die Gotico-Antiqua des Jörg Gartner: Die Schrift als designiertes Markenzeichen
12:30 ‒ 14:00 Uhr: Mittagspause
16:00 ‒ 17:30 Uhr: Albert DIETL (Regensburg): Visualisierung städtischer Ordnung und symbolische Kommunikation: Stadttor-Inschriften in mittelalterlichen Kommunen Italiens
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Tanja KOHWAGNER-NIKOLAI, Mirjam GOETH: Inschriften digital vermitteln ‒ Die Otto von Wittelsbach-Tapisserien und ihre Inschriften (Exkursion ins Residenz-Museum)
12:30 ‒ 14:00 Uhr: Mittagspause
14:00 ‒ 15:30 Uhr: Tanja KOHWAGNER-NIKOLAI, Mirjam GOETH: Inschriften digital vermitteln ‒ Produktion eines Erklärvideos (Workshop I)
16:00 ‒ 17:30 Uhr: Tanja KOHWAGNER-NIKOLAI, Mirjam GOETH: Inschriften digital vermitteln ‒ Produktion eines Erklärvideos (Workshop II)
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Martin WAGENDORFER: Konrad Peutinger und Johannes Fuchsmagen ‒ Zwei Inschriftensammler aus Süddeutschland um 1500
12:30 Uhr: Martin WAGENDORFER: Zusammenfassung und Verabschiedung
Martin.Wagendorfer@lrz.uni-muenchen.de
Franz.A.Bornschlegel@lrz.uni-muenchen.de
Sommerakademie „Epigraphik zwischen Kulturgeschichte und Digital Humanities“, München 1.-5. August 2022
Die Inschriften stellen aufgrund ihrer vielfältigen Thematik, der Spontaneität ihrer Aussage und ihres überwiegenden Verbleibs am ursprünglichen Anbringungsort eine historische Quelle ersten Ranges dar. Ebenso vielgestaltig wie ihre inhaltlichen Aussagen erweisen sich auch die Erscheinungsformen der Inschriften. Mit Text und Schrift, Methodik und Arbeitsweisen befasst sich im Rahmen einer Interdisziplinären Sommerakademie an der LMU München die einwöchige Veranstaltung „Epigraphik zwischen Kulturgeschichte und Digital Humanities“ vom 1. bis 5. August 2022 an der LMU München.
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Isabelle MOSSONG: Der epigraphische Nachlass der italischen Kleriker (5. ‒ 7. Jahrhundert): Akteure, Gattungen, Praxis
12:30 ‒ 14:00 Uhr: Mittagspause
14:00 ‒ 15:30 Uhr: Julia-Sophie HEIER, Kerstin MAJEWSKI, Gaby WAXENBERGER: Geritzt, gemeißelt und gestempelt ‒ Runeninschriften vom 2. bis ins 16. Jahrhundert, Teil 1: Einführung in die Runologie (Theorieteil)
16:00 ‒ 17:30 Uhr: Julia-Sophie HEIER, Kerstin MAJEWSKI, Gaby WAXENBERGER: Geritzt, gemeißelt und gestempelt ‒ Runeninschriften vom 2. bis ins 16. Jahrhundert, Teil 2: Runeninschriften transliterieren und interpretieren (Praxisteil)
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Rudolf HAENSCH, Eva HAVERKAMP-ROTT, Franz-Albrecht BORNSCHLEGEL, Ramona BALTOLU: Epigraphische Datenbanken (EDH, ECDS, EDR, Ubi-erat-lupa; epidat; Deutsche Inschriften Online, epigraphica europea)
12:30 ‒ 14:00 Uhr: Mittagspause
16:00 ‒ 17:30 Uhr: Christine STEININGER: Katholisch, evangelisch, divers? Inschriftendenkmäler als Quellen für das Bekenntnis in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Ramona BALTOLU: Die Gotico-Antiqua des Jörg Gartner: Die Schrift als designiertes Markenzeichen
12:30 ‒ 14:00 Uhr: Mittagspause
16:00 ‒ 17:30 Uhr: Albert DIETL (Regensburg): Visualisierung städtischer Ordnung und symbolische Kommunikation: Stadttor-Inschriften in mittelalterlichen Kommunen Italiens
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Tanja KOHWAGNER-NIKOLAI, Mirjam GOETH: Inschriften digital vermitteln ‒ Die Otto von Wittelsbach-Tapisserien und ihre Inschriften (Exkursion ins Residenz-Museum)
12:30 ‒ 14:00 Uhr: Mittagspause
14:00 ‒ 15:30 Uhr: Tanja KOHWAGNER-NIKOLAI, Mirjam GOETH: Inschriften digital vermitteln ‒ Produktion eines Erklärvideos (Workshop I)
16:00 ‒ 17:30 Uhr: Tanja KOHWAGNER-NIKOLAI, Mirjam GOETH: Inschriften digital vermitteln ‒ Produktion eines Erklärvideos (Workshop II)
11:00 ‒ 12:30 Uhr: Martin WAGENDORFER: Konrad Peutinger und Johannes Fuchsmagen ‒ Zwei Inschriftensammler aus Süddeutschland um 1500
12:30 Uhr: Martin WAGENDORFER: Zusammenfassung und Verabschiedung
Martin.Wagendorfer@lrz.uni-muenchen.de
Franz.A.Bornschlegel@lrz.uni-muenchen.de