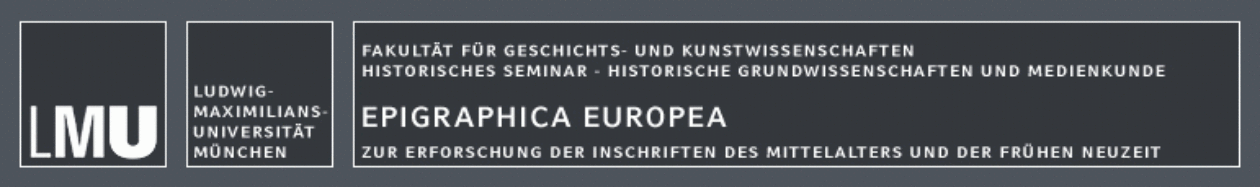Historische Graffiti als Quellen. Methoden und Perspektiven eines jungen Forschungsbereichs
20.-22. April 2017
Institut für Klassische Archäologie, LMU München, Katharina-von-Bora-St. 10, 80333 München
Veranstalterin: Dr. Polly Lohmann
Um Anmeldung wird gebeten unter: historischegraffiti@gmail.com
Tagungsprogramm:
Do., 20.4.2017: Katharina-von-Bora-Str. 10, Vortragssaal, 2. Stock
15:00 Anmeldung
15:30 Dr. Polly Lohmann – Begrüßung
Sektion I: Antike (Chair: Prof. Dr. Stefan Ritter, München)
16:00 Julia Preisigke (München): Graffiti an ägyptischen Tempeln: Quellen für den Zugang der Bevölkerung zu den Tempeln und das Problem ihrer Datierung
16:45 Prof. Dr. Angelos Chaniotis (Princeton): Die Graffiti von Aphrodisias: Ein Überblick
17:30 Kaffeepause
18:00 Dr. Polly Lohmann (München/Heidelberg): Römisches Alltagsleben im Spiegel der pompejanischen Graffiti
Öffentlicher Abendvortrag:
19:00 Prof. Dr. Stefan Ritter (München): Belebte Bilder: Dialogische Graffiti in pompejanischen „Kneipenszenen“
Anschließend Stehempfang
Fr., 21.4.2017: Katharina-von-Bora-Str. 10, Vortragssaal, 2. Stock
09:30 Prof. Dr. Hans Taeuber (Wien): Das tägliche Leben in Ephesos anhand der Graffiti im Hanghaus 2
10:15 Kordula Gostenčnik (Wien): Die Händlergraffiti aus der Stadt auf dem Magdalensberg
11:00 Kaffeepause
Sektion II: Mittelalter und Frühe Neuzeit (Chair: Dr. Christine Steininger, München)
11:30 Dr. Ulrike Heckner (Pulheim-Brauweiler): Spätgotische Handwerker-graffiti in der ehemaligen Klosterkirche St. Katharina in Wenau (Kreis Düren)
12:15 Prof. Dr. Romedio Schmitz-Esser (Graz): Graffiti als Quellen zur Sozialgeschichte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit am Beispiel Tirols
13:00 Mittagspause
14:00 Dr. Thomas Wozniak (Tübingen): Die Graffiti der ehemaligen Marienkirche auf dem Münzenberg in Quedlinburg
14:45 Simon Dietrich (Marburg): Die spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Graffiti in der Marburger Elisabethkirche – Befund, methodische Herausforderungen und Quellenwert
15:30 Kaffeepause
16:00 Prof. Dr. Detlev Kraack (Berlin/Plön): Adelige auf Reisen: Graffiti des 14.–16. Jahrhunderts
16:45 Dr. Ulrike Götz (München/Freising): „Nomina stultorum …“ – Graffiti des 18. Jahrhunderts im Karzer der ehemaligen bischöflichen Hochschule in Freising
Sa., 22.4.2017: Katharina-von-Bora-Str. 10, Vortragssaal, 2. Stock
Sektion III: Neuzeit (Chair: Prof. Dr. Irmgard Fees, München)
09:30 Dr. des. Daniel Schulz (Zug): Sprechende Wände: Graffiti aus dem Schloss Ludwigsburg
10:15 Dr. Andreas Effland (Göttingen): „Alle Namen auf diesem Heiligtum sind französisch” – Graffiti der napoleonischen Orientarmee in Ägypten
11:00 Kaffeepause
Öffentliche Abschlussvorträge, erster Lichthof (EG), in Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum:
11:30 Dr. Werner Jung (Köln): Zeugnisse der Opfer: Häftlingsgraffiti im Kölner Gestapogefängnis
12:30 Uta Fischer (Berlin): „O Wanze, o Wanze, o unheimliches Biest“ – Graffiti aus dem Ghetto Theresienstadt
13:30 Abschlussdiskussion und Konferenzende