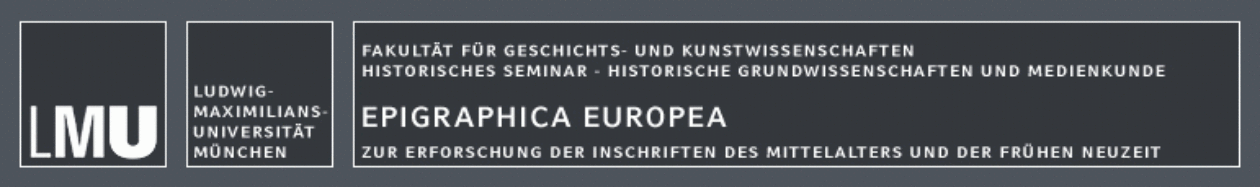INTERNATIONALE SUMMERSCHOOL. Materialität und Schriftlichkeit. Inschriften als Quellen der mittelalterlichen Kulturgeschichte, 9.-13. Juli 2018, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Geschichte.
Worum es uns geht
Die materielle Kultur des Mittelalters gehört zu den aktivsten Forschungsfeldern der Mediävistik, und erst seit vergleichsweise kurzer Zeit erfährt die Epigraphik dieser Epoche eine systematische Aufarbeitung. Die angebotene Summerschool kombiniert beide Ansätze miteinander und fragt nach dem kulturgeschichtlichen Mehrwert einer Beschäftigung mit der Schrift in ihren monumentalen (oder auch scheinbar marginalen) Zusammenhängen außerhalb des Archivs und der Bibliotheken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Summerschool erhalten Einblick in den Stand der epigraphischen Forschung und erlernen den Umgang mit Inschriften in situ. Dazu wird ein Großteil der Veranstaltungen in Exkursionen vor Ort in Graz erfolgen; die wichtigsten Wissenschaftsinstitutionen der Steiermark gehören zu den Partnern der Veranstaltung und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit mit Inschriften in verschiedenen Kontexten (Forschung, Konservierung, Geschichtsvermittlung). Interdisziplinäres Arbeiten stellt die Voraussetzung für jeden Umgang mit der materiellen Kultur dar. Entsprechend kombiniert und vermittelt die Summerschool „Materialität und Schriftlichkeit“ Arbeitstechniken u.a. aus der Mediävistik, den Digital Humanities, der Kunstgeschichte, Archäologie, Latinistik und Germanistik. Der Kurs, der die entsprechende Expertise vor Ort bündelt und zugleich durch international anerkannte Lehrende erweitert, zielt vor allem auf Masterstudierende und Diplomandinnen bzw. Diplomanden aus dem deutschsprachigen Raum (Österreich, Schweiz, Deutschland, Südtirol).
Was Sie erwartet
Zentrales Anliegen der Summerschool „Materialität und Schriftlichkeit“ stellt die Verbindung folgender drei Ansätze dar:
(1) Die Anschauung vor Ort. Die Schriftlichkeit im urbanen Raum und auf gesammelten Objekten wird am Beispiel des in der Stadt Graz vorhandenen, reichen Kulturerbes mit den Teilnehmerinnnen und Teilnehmern
gesichtet, diskutiert und aktiv erforscht. Die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannte steirische Landeshauptstadt bietet mit dem Joanneum, seinen zahlreichen Außenstellen, mehreren historisch gewachsenen Ensembles (etwa dem Dom- und Burgkomplex, den historischen Stadtmauern, dem Zeughaus und der Leechkirche) dafür ausgezeichnete Grundbedingungen.
(2) Die theoretische Reflexion interdisziplinärer Zugänge. In Miniworkshops mit in ihren Feldern international ausgewiesenen Expertinnen und Experten bietet die Summerschool Einblick in den Umgang, die Erfassung und kulturhistorische Aufbereitung von Inschriften.
(3) Die direkte Arbeit mit den Realien. Ziel und Ergebnis der Teilnahme bestehen in der Bearbeitung einer im Rahmen der Begehungen selbstgewählten Inschrift und ihres Trägers, die in eine Katalognummer nach den Vorgaben des einschlägigen Editionsvorhabens „Die Deutschen Inschriften“ (DI) münden. Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Lehrenden im Prozess der Bearbeitung angeleitet und betreut.
Nach erfolgreichem Abschluss der Summerschool erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein entsprechendes Zertifikat der Karl-Franzens-Universität Graz.
Vortragende
Franz-Albrecht Bornschlegel (Ludwig-Maximilians-Universität München), Meinhard Brunner (Historische Landeskommission für Steiermark), Matthew Champion (University of East Anglia), Albrecht Classen (University of Arizona, Tucson), Marina Đurovka (Technische Universität Graz), Ursula Gärtner (Karl-Franzens-Universität Graz), Johannes Gießauf (Karl-Franzens-Universität Graz), Max Grüntgens (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz), Sonja Hermann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Anna Lidor-Osprian (Karl-Franzens-Universität Graz), Joanna Olchawa (Universität Oldenburg), Romedio Schmitz-Esser (Karl-Franzens-Universität Graz), Thomas Kollatz (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte), Wolfgang Spickermann (Karl-Franzens-Universität Graz), Georg Vogeler (Karl-Franzens-Universität Graz), Andrea Worm (Karl-Franzens-Universität Graz), Andreas Zajic (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien).
Was Sie mitbringen
Die Bewerbung steht prinzipiell allen Studierenden eines geisteswissenschaftlichen Faches an einer Universität oder vergleichbaren Institution offen. Ein Interesse an der Arbeit mit materieller Kultur, Freude am interdisziplinären Arbeiten (manchmal auch jenseits der eigenen Fähigkeiten), keine Scheu vor Hands-on-Experiences und dem Verlassen des Seminarraums (regenfeste Kleidung und gutes Schuhwerk sind kein Fehler!) sind
wichtige Voraussetzungen für die Teilnahme. Erwartet wird die aktive Mitarbeit, zu der auch eine vorbereitende Lektüre und die Nachbearbeitung des eigenen Inschriftenprojekts gehören. Ratsam ist ein fortgeschrittener Studienverlauf, etwa in Form eines abgeschlossenen Bachelor-Studiums oder einer bereits erfolgten ersten Zwischenprüfung eines Diplom- oder Magisterstudiengangs. Gute Grundkenntnisse in Deutsch, Latein und Englisch sind sinnvoll, um den Vorträgen und der Diskussion folgen zu können. Paläographische Vorkenntnisse sind willkommen, aber keine zwingende Voraussetzung; der Erwerb von Kenntnissen in diesem Bereich ist wichtiger Gegenstand der Summerschool.
Für die Teilnahme an der Summerschool „Materialität und Schriftlichkeit“ ist eine schriftliche Bewerbung erforderlich. Diese umfasst ein kurzes, einseitiges Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und einen Überblick
der bisherigen Studienleistungen. Diese Unterlagen übermitteln Sie bitte postalisch oder per E-Mail bis 15. Mai 2018 an: Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Geschichte, Fachbereich Allgemeine Geschichte des Mittelalters und Historische Hilfswissenschaften, Johanna Goller, Heinrichstraße 26/III, 8010 Graz, Österreich, johanna.goller@uni-graz.at
Aus den Bewerbungen werden 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt. Für die Teilnahme fallen Kosten von 300 € (inkl. sechs Übernachtungen im Zweibettzimmer während des Kurszeitraums) bzw. 150 € (ohne zentral organisierte Übernachtung) an. Für die angenommenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es die Möglichkeit, sich für ein Stipendium zu bewerben. Bitte geben Sie bereits bei Ihrer Bewerbung an, ob Sie ggf. für dieses Stipendium berücksichtigt werden möchten. Die Stipendien werden nach Maßgabe vorhandener Mittel und unter Berücksichtigung des bisherigen Studienerfolgs vergeben.
Organisatoren: Johannes Gießauf und Romedio Schmitz-Esser, Fachbereich Allgemeine Geschichte des Mittelalters und Historische Hilfswissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz
Kontakt und Information: Johanna Goller, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Geschichte, Fachbereich Allgemeine Geschichte des Mittelalters und Historische HilfswissenschaftenHeinrichstraße 26/III, 8010 Graz, Österreich, johanna.goller@uni-graz.at
Anmeldung bis zum 15. Mai 2018