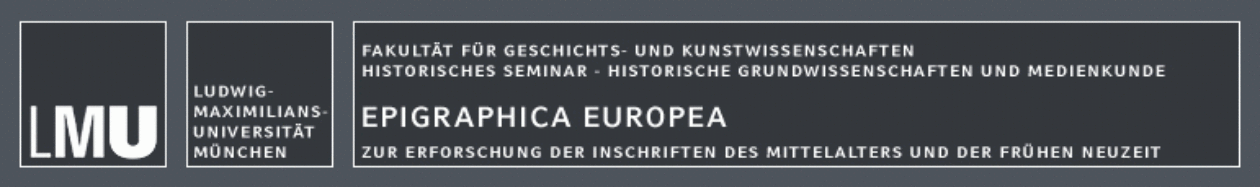Der Kaiser und sein Grabmal 1517-2017. Neue Forschungen zum Hochgrab Friedrichs III. im Wiener Stephansdom, herausgegeben von Renate Kohn unter Mitarbeit von Sonja Dünnebeil und Gertrud Mras. 521 S., 410 s/w- und farb. Abb., Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2017. ISBN 978-3-205-20640-8, € 70,-
Anlässlich der 500. Wiederkehr der endgültigen Beisetzung Kaiser Friedrichs III. entstand dieser inhalts- und ertragreiche Band, dem im Jahre 2013 eine interdisziplinäre Fachtagung vorausging, um das Grabmal des Kaisers im Wiener Stephansdom unter verschiedenen Blickwinkeln einer fundierten wissenschaftlichen Analyse zu unterziehen. Dafür konnte Renate Kohn, die im Rahmen der interakademischen Editionsreihe „Die Deutschen Inschriften“ die Inschriften des Wiener Stephansdoms wissenschaftlich bearbeitet, namhafte Vertreter aus den Bereichen Geschichte, Kunstgeschichte, Epigraphik, Heraldik, Philologie und Theologie, aber auch der Bildhauerkunst gewinnen. Insgesamt 16 Beiträge verteilen sich auf die Kapitel „Zur Person Friedrichs III.“ (Paul-Joachim Heinig, Sonja Dünnebeil, Annemarie Fenzl), „Das Grabmal“ (Artur Rosenauer, Walter Koch, Harald Drös, Ulrich Söding, Renate Kohn, Cornelia Plieger, Reinhard H. Gruber), „Zur Entstehung des Grabmals“ (Michael V. Schwarz, Stefanie Menke, Manfred Hollegger, Andreas Zajic) und „Aus der Praxis“ (Franz Zehetner, Philipp Stastny), wobei nicht nur die einschlägigen epigraphischen Beiträge von Walter Koch, „Die Frühhumanistische Kapitalis. Eine epigraphische Schrift zwischen Mittelalter und Neuzeit im Umfeld Kaiser Friedrichs III.“ (S. 89-118) und Andreas Zajic, „Epigraphisch-antiquarischer Habitus und literarische Stilübung, oder: Wie gestaltet und beschreibt man ein Grabmal >humanistisch<?“ (S. 369-416) von inschriftenkundlicher Relevanz sind. (FB)