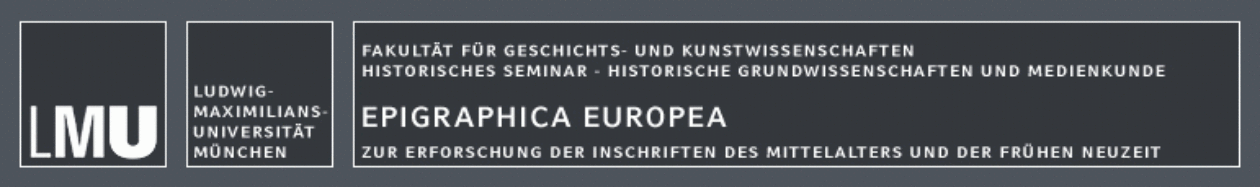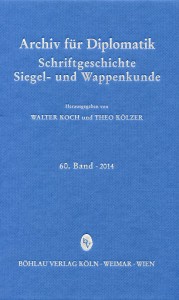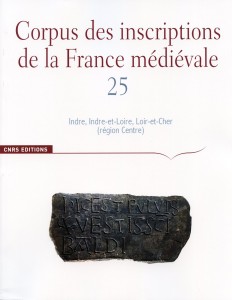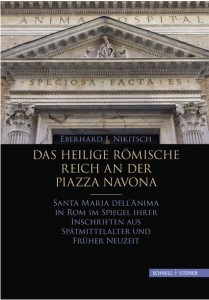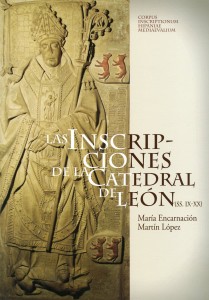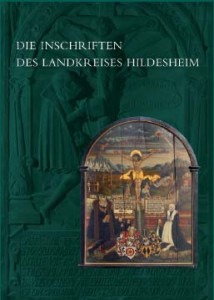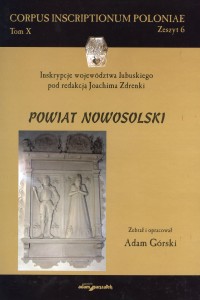Epigraphie médiévale: raisons d’écriture11 décembre – 12 décembre 2014, MadridColloqueProgramme EPIMEDVoir le détail |
Coord. : Carles Mancho (Universitat de Barcelona) et Cécile Treffort (Université de Poitiers)
Org. : École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), UMR 7302 (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers), Institut de Recerca en Cultures Medievals (Universitat de Barcelona)
Lieu de célébration :
Casa de Velázquez
C/ de Paul Guinard, 3
28040 Madrid
Programme
Jeudi 11 décembre
9h30-13h30
Ouverture
Michel Bertrand
Directeur de la Casa de Velázquez
Introduction
Carles Mancho
Universitat de Barcelona
El Proyecto EPIMED
Raisons d’écrire dans le monde médiéval
Présidence
Carles Mancho
Universitat de Barcelona
Cécile Treffort
Université de Poitiers
Fixer, transmettre, afficher : l’écriture, le temps et l’espace
Meritxell Blasco
Universitat de Barcelona
Escribir en el mundo judío medieval
15h30-19h30
Écrire son identité
Présidence
Javier del Hoyo
Universidad Autónoma de Madrid
Morgane Uberti
Chercheur indépendant
Écrire son nom sur le tombeau : les inscriptions funéraires entre Loire et Pyrénées (IVe-VIIIe siècle)
Antoni Cobos
Chercheur indépendant
La epigrafía en el condado de Gerona
Émilie Mineo
Université de Poitiers
L’artiste, l’écrit et le monument : enjeux de la signature épigraphique
Milagros Guardia
Universitat de Barcelona
Escribir y pintar sobre el muro
Vendredi 12 décembre
9h30-13h30
Du manuscrit à l’inscription
Présidence
Estelle Ingrand-Varenne
UMR 7302 (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers)
Rebecca Swanson
Universitat de Barcelona
Escribir en Roda de Isábena
Tomasz Płóciennik
Uniwersytet Warszawski (Pologne)
Errare humanum est : les „fautes“ épigraphiques, traces des minutes manuscrites
Marie Vallée
Chercheur indépendant
Les graffitis sur table d’autel dans le Midi de la France et en Catalogne : une pratique juridique sacralisée ?
Conclusions
Daniel Rico Camps
Universitat Autònoma de Barcelona
16h-19h
Réunion de programmation et de financement EPIMED 2014-2016 / Reunión de programación y de financiación EPIMED 2014-2016
Présentation du projet Sacra tempora par Isabel Velázquez Soriano (Universidad Complutense de Madrid) / Presentación del Proyecto Sacra tempora por Isabel Velázquez Soriano (Universidad Complutense de Madrid)